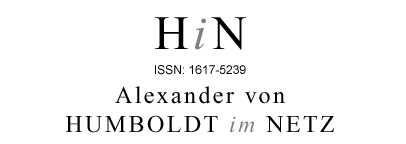
______________________________________________________
Krzysztof Zielnica
Karolina Jaenisch-Pavlova, Adam Mickiewicz und
Alexander von Humboldt. Ein Beitrag zu den deutsch-russisch-polnischen
Literaturbeziehungen des 19. Jahrhunderts6. Ein Loblied auf Humboldt
Karolina von Jaenischs dichterische Tätigkeit in der ersten Hälfte der 1830er Jahre beschränkte sich fast nur auf das Übersetzen russischer Dichtung ins Deutsche und Französische. Ins Deutsche übertragenen Gedichte erschienen in der Sammlung „Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Litteratur von Karoline von Jaenisch“. Den Band füllen größtenteils Übersetzungen von Puškins Werken. Nur im Anhang wurden einige ihrer Originalgedichte abgedruckt. In der Vorrede schrieb die Dichterin, daß sie von keinem anderen als von Alexander von Humboldt zu ihrem dichterischen Schaffen angeregt wurde:
Herr von Humboldt, dessen Bekanntschaft zu machen ich während seines kurzen Aufenthalts in Moscau das Glück hatte, war es, der den ersten Anlaß zu diesen Versuchen gab, indem er, sich mit mir über den gegenwärtigen Zustand der Dichtkunst Russlands unterhaltend, äußerte, daß es sehr zu wünschen wäre, von derselben durch ganz treue Übersetzungen eine nähere Kenntnis zu erlangen, und mich aufmunterte, diese Arbeit anzufangen.[1]
Unter den eigenen Gedichten verdient das folgende Sonett besondere Beachtung:
An A. v. H-mb--dt.
Mir ward ein Kranz von leuchtenden Secunden,
Ein Sonnenlicht fiel in mein stilles Leben;
Doch kaum wagt’ ich das Auge zu erheben,
So war es schon vergangen und verschwunden. –Im dunkeln Daseyn giebt es helle Stunden,
Die, schönen Wundern gleich, herniederschweben;
Sie sind uns als ein ewig Gut gegeben,
Denn nimmer welket, was wir dann empfunden.Doch wenn der Strahlenaugenblick verglommen,
Dann fühlen doppelt wir des Lebens Leere,
Gemeiner dann erscheinet uns die Menge:Denn als entzückt Cäcilie vernommen
Die Harmonie’n der sel’gen Engelchöre,
Verletzten sie die irdischen Gesänge. -
Titelseite des 1833 in Dresden und Leipzig herausgegebenen Gedichtsbändchens von Karoline von Jaenisch.
Sonett „An A. v. H-mb—dt“ von Karoline von Jaenisch in: Das Nordlicht, Dresden und Leipzig 1833.
Dieses Sonett entstand wahrscheinlich im Sommer 1829, nachdem Humboldt sich von den Zwiebelkuppeln der Moskauer Kirchen verabschiedet hatte und nach St. Petersburg geeilt war, um vom Zaren und der Kaiserin die gebührenden Lobreden, Orden und Geschenke in Empfang zu nehmen und die Expedition nach Sibirien zu beginnen.
Literaturkritiker und Slawisten haben Zweifel angemeldet, ob jener silbergefiederte fast sechzigjähriger Wandervogel die sich gerade an die ersten selbstständigen Flugversuche wagende Schwalbe wirklich so tief beeindrucken konnte. Man hat eher vermutet, daß Humboldts Abreise ihre noch nicht vernarbte Wunde aufgerissen habe, die ihr die neuerliche Trennung (27. Mai 1829) von Adam Mickiewicz zugefügt hatte. In dem hier wiedergegebenen Sonett von Karolina von Jaenisch haben Kritiker eine gewisse Ähnlichkeit mit den letzten Versen von „Konrad Wallenrod” zu erkennen geglaubt, dessen Teile die junge Moskauerin mit Humboldts Hilfe Goethe übersandt hatte. Wacław Lednicki (1891-1967), ein angesehener Slawist und Spezialist für die literarischen Wechselbeziehungen zwischen Rußland und Polen, hat sich mit dieser Frage in einer interessanten Skizze näher beschäftigt.[2] Seine Ausführungen und Schlußfolgerungen lehnten sich dabei vor allem an die Meinung des französischen Slawisten M. Gorlin an. Danach habe die Dichterin ihr Sonett zwar Alexander von Humboldt zugeeignet, die Leitmotive – Trennung und Traum – scheinen aber zu tief empfunden zu sein, um mit der Abreise des zwar berühmten, aber mit der Dichterin doch eher flüchtig bekannten Gelehrten erklärt werden zu können. Als Karolina ihr Gedicht schrieb, dachte sie eher – so Lednicki – an ihren soeben ins Exil abgereisten Geliebten, den sie bis ins hohe Alter nicht vergessen sollte. Es ist aber durchaus möglich – fügt Lednicki hinzu – daß das Erscheinen einer wohlgeneigten und weltberühmten Personönlichkeit die Verzweiflung der Poetin lindern und ihren Seelenfrieden in gewissem Grade wiederherstellen konnte.
Der Krakauer Slawist fügte in seinem aufschlußreichen Essay hinzu, daß die Zuneigung Karolinas für den Mathusalem der deutschen Wissenschaft, wie er den Forschungsreisenden nannte, durch ein scheinbar nichtiges Ereignis verursacht oder verstärkt werden konnte, und zwar durch das im Jahre 1829 erschienene Gedicht von Mickiewicz mit dem Titel „Do Doktora S.“ („An den Doktor S.“), in dem Humboldt namentlich erwähnt wird.[3] Jener „Doktor S.” war Alexander Siemaszko, ein junger Arzt aus Wilna, der nach dem Abschluß seiner Studien an der dortigen medizinisch-chirurgischen Akademie „eine wissenschaftliche Reise nach Asien zu naturgeschichtlichen Zwecken vorhatte”, wie im Untertitel dieses Gedichtes zu lesen ist. Auf dem Weg nach Astrachan machte er am 17. Januar 1827 in Moskau Station, wo ihm die polnische Kolonie einen warmen Empfang bereitete. Vor seiner Weiterreise veranstalteten die Landsleute eine Soiree auf der der Ehrengast das erwähnte Gedicht vortrug. Es erzählt von der Natur, insbesondere vom Innern der Erde, deren Geheimnisse der in die Astrachaner Wüste eilende Naturforscher belauschen möchte. Der Dichter ermuntert den jungen Gelehrten zu paläontologischen und petrographischen Forschungen, um das Verborgenste unsereres Planeten zu entdecken und zu beschreiben. Die Chronik der Erde sei in deren Felsschichten versteckt und verewigt worden. Der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Geheimnissen liege bei Humboldt und sei in seinen Werken und in seiner Lehre zu suchen. Das Fragment hat folgenden Wortlaut:
Za twym skinieniem, władco cudotwornej laski,
Trysną źródłem nauki astrachańskie piaski,
Każemy pękać górom, znidziem w ich ciemnotę
Zważać w kuźni natury klejnotów robotę.
Ja bogactw nie łakomy, cenię wynalazki,
W których wielkie pamiątki, choć pomniejsze blaski.
Odszedłbym od brylanty rodzącego szystu
Do geodów zamkniętych na klucz z ametystu
Wiesz ich początek? - między edeńskimi drzewy,
Kiedy nasz ojciec pierwszy raz westchnął do Ewy,
Ziemia to pierworodne miłości westchnienie
Złowiła i w kosztowne zawarła kamienie.
Te prawdy, po hebrajsku zapisane w skałę,
W tajnych archiwach ziemi leżą skamieniałe.
Od Humboldta weź klucze na te alfabety
I stań się biografem naszego planety;
Niech cię nie trwoży żmudne latopismo świata,
Z warstw ziemi, jak ze zmarszczków, policzysz jej lata.[4]Hier die etwas unbeholfen klingende Übersetzung von Carl von Blankensee:
Winke nur, o Wunderthäter, mit dem Stab in deiner Hand
Und die Quelle der Belehrung sprudelt Astrachanscher Sand
Auf thut sich der Berg, wir steigen nieder in den Schoss der Erden,
Und, Natur, in deiner Werkstatt sehn wir Edelste werden.
Ich bin nicht nach Reichthum gierig, doch mit Lust es mich erfüllt,
Wenn, des Prunkes bar, Entdeckung uns Denkwürdig würdigstes enthüllt.
Dahin würde mich es treiben von dem demantreichen Boden,
Wo mit amethyst’nem Schlüssel sich verschliessen die Geoden.
Kennst den Ursprung du von ihnen? - Als in Edens wonn’gem Thal
Unser Vater bang zu Even seufzete das erste mal,
Sog die Erde diesen ersten Liebesseufzer in sich ein,
Und verschloss, ihn treu zu wahren, ihn in köstliches Gestein.
Kunde hievon, in die Felsen mit hebrä’scher Schrift geätzt,
Heimlich in der Erd’ Archiven liegt versteinert sie noch jetzt.
Lass von Humboldt dir die Schlüssel leihn zu diesen Alphabeten,
Und ein würd’ger Biographe werde unserem Planeten.
Von der Welt mühseel’ger Chronik lasse nimmer ab dich schrecken:
Aus den Schichten, wie aus Runzeln, wirst ihr Alter du entdecken. [5]
[1] Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Litteratur von Karoline von Jaenisch. Erste Lieferung. Dresden und Leipzig 1833, S. VIII.
[2] Wacław Lednicki: Wiersze Karoliny Pawłow (Jaenisch) do Mickiewicza. In: Wacław Lednicki: Przyjaciele Moskale. Kraków 1935, S. 242-259; 257. Anm. 1.
[3] Ebd., S. 258.
[4] Mickiewicz, Adam: Wybór pism. Warszawa 1952, S. 62-63.
[5] Mickiewicz, Adam: Sämmtliche Werke. Erster Theil. Gedichte. Aus dem Polnischen übertragen von Carl von Blankensee. Berlin 1836, S. 243-244.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>