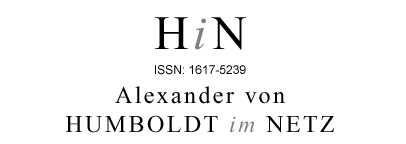
______________________________________________________
Krzysztof Zielnica
Karolina Jaenisch-Pavlova, Adam Mickiewicz und
Alexander von Humboldt. Ein Beitrag zu den deutsch-russisch-polnischen
Literaturbeziehungen des 19. Jahrhunderts4. Mit Adam Mickiewicz verlobt
Für die literarischen Kreise Moskaus war der Winter 1826/1827 eine denkwürdige Zeit. Adam Mickiewicz, der von vielen Zeitgenossen mit dem romantischen Byronschen Ritter Harold („Child Harold’s Pilgrimage”) verglichen wurde, kehrte von seinem Zwangsaufenthalt in Odessa zurück und wurde von der Moskauer literarischen Gesellschaft überaus freundlich und schwärmerisch aufgenommen. Kurz darauf – am 8. September 1826 – kehrte auch Aleksander Sergeevič Puškin (1700-1837) aus der Verbannung zurück und wurde in den Salon der Fürstin Volkonskaja eingeführt, die ihn mit ihrer Schönheit, Klugheit und Liebenswürdigkeit bezauberte. Ein besonderes Erlebnis in diesem ungewöhnlichen Hause war ein literarisches Essen, das die zahlreichen Freunde und Anbeter Mickiewicz zur Ehre am 24. Oktober 1826, kurz vor seiner Abreise nach Petersburg, gaben und zu dem, neben Puškin auch E. A. Baratynskij, A. S. Chomjakov, I. V. Kireevskij, M. P. Pogodin, S. A. Sobolevskij, A. V. Venevitinov und Fürst P. A. Vjazemskij eingeladen wurden. Während des Empfangs schlug man verschiedene Themen zur Improvisation vor und erkannte die Siegespalme Mickiewicz zu. Der Dichter erfreute sich großer Beliebtheit und hohen Ansehens bei der Fürstin Volkonskaja. Sie behandelte ihn mit gleichbleibendem Wohlwollen und schätzte ihn sowohl als Menschen als auch als Dichter. In ihrem Salon war er deshalb einer der beliebten und mit Ehren empfangenen Gäste. Dort soll ihn im Jahre 1826 auch Karolina Jaenisch gesehen haben und tief von ihm beeindruckt worden sein. Um sich dem Dichter zu nähern und seine Werke im Original lesen zu können, bat sie ihren Vater, Mickiewicz als ihren Polnischlehrer anzustellen. Dieser entdeckte bald die ungewöhnliche Sprachbegabung und Belesenheit seiner Schülerin. Auch ihr zeichnerisches Talent entzückte ihn, so daß er sie in seinem späteren Briefwechsel Malerin („Malarka”) nannte. Es wird berichtet, daß die blutjunge Karolina dem Dichter während der Lektionen ihre Neigung bekannt haben soll und daß sich zwischen ihnen schnell eine intime Beziehung entwickelte. Ob es zu einer offiziellen Verlobung kam, läßt sich nicht eindeutig klären. Karolina behauptete, Mickiewicz habe ihr eine Liebeserklärung gemacht und ihr eine Heirat vorgeschlagen. Noch über 60 Jahre später erwähnte sie in einem Brief an Władysław Mickiewicz, den ältesten Sohn des Dichters, den „glücklichen Tag, an dem der Gegenstand meiner grenzlosen Liebe fragte, ob ich seine Frau werden wolle.”[1]
Ihre Hoffnungen zerrannen aber schnell. Die wohlhabende und geachtete Familie Jaenisch konnte sich nicht damit abfinden, daß ihre einzige Tochter und Nichte einen armen, unbedeutenden und dazu noch politisch „unzuverlässigen” Litauer heiraten sollte. Der reiche Onkel, Verwalter des gesamten Familienvermögens, drohte sogar mit der Enterbung seines Bruders, was ihn und seine Familie in Not und Elend gestürzt hätte. Ihre Unentschlossenheit und der verletzte Stolz des deprimierten jungen Dichters führten bald zu einer äußerlichen Abkühlung dieses heißen Verhältnisses und die Verbindung brach mit seiner Übersiedlung nach Petersburg Ende 1827 fast gänzlich ab. Dennoch schrieb sie zwei Jahre später den folgenden leidenschaftlichen Brief:
Moscou, le 19 Fevriér 1829.
Je vous écris quelques lignes pour vois prier en grâce de venir à Moscou, aussitôt qu’il vous sera possible. Je vois que je ne puis supporter plus longtemps cet état d’incertitude, cette attente continuelle, cette éternelle agitation. Il faut que mon sort se décide d’une maničre ou une autre. Je serais plus tranquille, si je n’avais plus rien à perdre.
Dix mois se sont écoulés depuis votre départ; j’ai beaucoup réfléchi pendant ces dix mois d’absence: j’ai vu que je ne pouvais vivre sans penser à vous, j’ai vu que toute mon existence n’était qu’un souvenir continuel, Mickiewicz! quelque chose qu’il arrive, mon âme est à tois. Si je ne puis vivre pour toi, ma vie est finie – mais alors même je ne me plaindrai pas. N’ai -je pas été mille fois plus heureuse que je n’ai pu l’espérer? Je t’ai rencontré, je t’ai connu, j’ai compris – oui, je puis le dire, par la puissance de mon amour j’ai compris ton âme! Tu m’as aimée – que malheur peut étre aussi grand que cette félicité?[2]Trotz dieser Herzensergüsse und Beschwörungen konnte jene romantische Verbindung keinen glücklichen Ausgang haben. Unakzeptiert durch die Familie Jaenisch, beobachtet durch die zaristische Polizei, ermüdet von der Zensur, sah der sensible Dichter keine Zukunft mehr in dem feindseligen Land und sann nur darauf, sich der Verbannung entziehen zu können. Vor seiner endgültigen Auswanderung reiste er im April 1829 noch einmal nach Moskau und traf dort mit Karolina Jaenisch zusammen. Er eröffnete ihr seinen festen Entschluß, Rußland für immer zu verlassen und nach dem Westen zu gehen. Am 5. April 1829 nahm sie mit gefühl- und leidvollen Zeilen in deutscher Sprache Abschied von Mickiewicz. Sie beteuerte ihm ihre ewige Liebe, die nach der Trennung nur noch tiefer sein werde.[3] Am 6. April 1829 trug er in ihr Stammbuch ein schönes Gedicht[4] ein. Karolina blieb Zeit ihres Lebens dem reinen und unglücklichen Gefühl für den polnischen Dichter treu. Noch 61 Jahre später schrieb sie aus Hosterwitz bei Dresden an seinen ältesten Sohn Władysław: „Für mich hat er nicht zu leben aufgehört. Ich liebe ihn heute, wie ich ihn über so viele Jahre der Anwesenheit hinweg geliebt. Er ist mein, wie er es einst war.“[5]
Nach seiner langjährigen Verbannung in Rußland, ging Adam Mickiewicz ins Exil nach Frankreich, nachdem er sich am 15.(27.). Mai in Kronstadt nach Lübeck eingeschifft hatte.[6]
[1] Mickiewicz, Władysław, a.a.O., S. 271.
[2] Ebd., S. XLIV.
[3] Mickiewicz, Władysław, ebd., S. XLV.
[4] Kalendarz domowy dla wsi i miasta na rok zwyczajny 1873, S. 82; Adam Mickiewicz: Dzieła, hrsg. von J. Krzyżanowski. Bd 1. Warszawa 1955, S. 541; M. Vasmer: Russische und polnische Gedichte im Nachlaß von Karoline Pavlova. In: Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 27:1958, S. 45; Deutsche Übersetzung bei Lettmann-Sadony, ebd., S. 30.
[5] Ebd., S. 273 (Brief v. Pavlova an Władysław Mickiewicz vom 20. April 1890).
[6] Zwei Polen in Weimar (1829). Ein Beitrag zur Goetheliteratur, aus polnischen Briefen übersetzt und eingeleitet von Franz Thomas Bratranek. Wien 1870, S. 29.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>