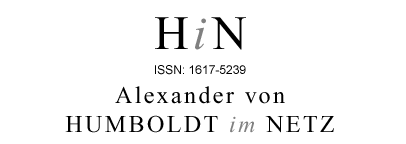
|
Archivkopie der Website http://www.humboldt-im-netz.de |
|---|
______________________________________________________
Engelhard Weigl
Wald und Klima: Ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert
5. Die Verwandlung der Wüste in einen Garten
Den Degenerationsängsten in Europa stehen in der Neuen Welt Hoffnungen auf eine Regeneration gegenüber. Für die amerikanischen Transzendentalisten geht vom Wald eine Erneuerungskraft aus, die den Menschen wieder zum lebendigen Teil der Schöpfung macht. Im Wald fühlt sich der Mensch von Gott durchströmt, verjüngt, geheilt, unverwundbar. “In the woods is perpetual youth. Within these plantations of God, a decorum and sanctity reign, a perennial festival is dressed, and the guest sees not how he should tire in a thousand years. In the woods we return to reason and faith. There I feel that nothing can befall me in life, - no disgrace, no calamity [...], which nature cannot repair,” schreibt Emerson.[1] Es entsteht eine Nähe zur Natur, die an die okkulte Verbindung zwischen Mensch und Pflanze erinnert. Doch das Wirkungsvermögen des Waldes vermag auch ganz konkrete Züge anzunehmen. Mit der Entstehung des Mythos vom amerikanischen Westen werden ihm bei der Besiedlung der Great Plains, der Region westlich vom Missouri und östlich der Rocky Mountains, heute die Staaten Kansas und Nebraska, physikalische Kräfte bei der Beschaffung von Regen zugeschrieben. Wissenschaft und Mythos verbanden sich, um die Bedingungen der Natur den Wünschen des Menschen unterzuordnen. Für eine kurze Periode von 1865 - nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg - bis 1890 wird dem Wald bei der massenhaften Besiedlung des Westens das Vermögen zur Verwandlung des weiten baumlosen, trockenen Landes in einen Garten Eden zugetraut. Die menschenleere „Wüste“, häßlich und wertlos für die ersten Entdecker, sollte für die Kleinbauern aus dem Osten und Europa zum Land der Zukunft ausgebaut werden. Der Westen enthielt ein großes Versprechen: Freiheit, Unabhängigkeit und moralische Gesundung von den negativen Auswirkungen von Urbanisierung und Industrialisierung. Thoreau hat diesen Traum, der die amerikanische Selbstfindung und Ablösung von Europa einleitete, 1862 in seinem Essay „Walking“ poetisch erfaßt: “Eastward I go only by force; but westward I go free. Thither no business leads me. It is hard for me to believe that I shall find fair landscapes or sufficient wilderness and freedom behind the eastern horizon. I am not excited by the prospect of a walk thither; but I believe that the forest which I see in the western horizon stretches uninterruptedly toward the setting sun, and there are no towns nor cities in it of enough consequence to disturb me. [...] I must go towards Oregon, and not towards Europe. And that way the nation is moving, and I may say that mankind progress from east to west.”[2] Im Osten finden sich Geschichte, die Orte, wo wir Kunst und Literatur studieren, wo wir die Schritte der menschlichen Zivilisation zurückverfolgen können; dort liegt unsere Vergangenheit, doch im Westen liegt die Zukunft, mit dem Geist für neue Unternehmungen und Abenteuer. “Humboldt came to America to realize his youthful dreams of a tropical vegetation, and he beheld it in its greatest perfection in the primitive forests of the Amazon, the most gigantic wilderness on the earth, which he so eloquently described.”[3] Alexander von Humboldts Bewunderung des äquatorialen Regenwaldes begründete die Überlegenheit der amerikanischen Natur über die europäische, der Jugend über das Alter, der jungfräulichen Erde über die ausgelaugte. Völker leben, solange ihre urzeitlichen Wälder dauern. Die so lange leben, so lange die Erde nicht erschöpft ist. “Alas for human culture! little is to be expected of a nation, when the vegetable mould is exhausted, and it is compelled to make manure of the bones of its fathers.”[4] Humboldts Wissenschaft festigte den Glauben, daß es im Zentrum Amerikas keine Wüste geben könne,[5] und seine Studien zum Wasserhaushalt des Waldes lieferten seinen Anhängern die Argumente, daß sich der Regen auch dorthin bringen ließ, wo er bisher kaum fiel. Nicht nur Romantiker, Forstwissenschaftler und Botaniker, die angesehensten wissenschaftlichen Institutionen der Vereinigten Staaten, Smithsonian Institution und United States Geological and Geographical Survey of the Territories stellten sich in den Dienst der Theorie, daß ein Aufforstungsprogramm der Great Plains dem Land den so sehr entbehrten Regen beschaffen könnte. Es schien, als ob Amerikas Vakuum in der Mitte mit Menschen und Wäldern gefüllt werden müßte, um die Einheit des Landes zu sichern. Wuchs im amerikanischen Osten wie in Europa um die Mitte des Jahrhunderts die Sorge, daß die Entwaldung zu weit gegangen sei, daß sich Anzeichen fänden für eine zunehmende Unbeständigkeit des Wetters und Klimas, Sturzfluten und Dürren sich abwechselten, die Ströme unregelmäßiger fließen würden, die Mühlenteiche entweder verschwänden oder an Umfang abnähmen, so entstand im Westen mit dem zunehmenden Besiedlungsdruck die Hoffnung mit einem Aufforstungsprogramm, das Land für die Landwirtschaft erschließen zu können. Die Theoretiker, auf die man sich in beiden Fällen bezieht, sind dieselben. So schreibt ein Regierungsbeauftragter 1849: “The cutting down of too much timber in some parts of the country has operated to change, in some degree, the climate, and render large districts more subject to alternate droughts and rainy seasons. In summer, when frequent and moderate rains are greatly needed, the air is too dry to yield much more than respectable dews, for many weeks in succession. To learn the well-authenticated result of clearing forests, in drying up natural springs, and changing climates, regularity of rains, etc., the reader is referred to the writing of Humboldt, Kaentz, Forbes, Boussingault, and other meteorologists.”[6] Daniel Lee, Arzt und Amateurmeteorologe wagt als einer der Ersten die umgekehrte Schlußfolgerung. Die Plains waren baumlos, entweder durch die Feuer der Indianer oder durch natürlichen Bedingungen, in jedem Falle war Lee zuversichtlich, daß sich durch Bäume der Niederschlag erhöhen ließe. Auch er bezieht sich auf Humboldt.[7]
In den 70er Jahren wurde Land jenseits des 96. Meridians im östlichen Kansas und Nebraska erschlossen, wo der jährliche Regenfall alle paar Jahre unter das Niveau fallen konnte, das noch traditionelle Landwirtschaft ermöglichte. Günstige Perioden mit überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen bestärkten zuerst den Glauben, das das Vordringen der Zivilisation den Regen nach sich ziehe. Eisenbahngesellschaften und die siegreiche Republikanische Regierung versprachen nach dem Bürgerkrieg die Entwicklung eines Gartens Eden und sie beriefen sich paradoxerweise gerade auf die Theoretiker, die sich so pessimistisch zur landnehmenden Kultivierungsarbeit des Menschen geäußert hatten. Das Buch “Man and Nature” von George Perkins Marsh (1864) wurde zur Bibel aller Wissenschaftler, die sich für die Besiedlung des Westens einsetzten. Seine breite Diskussion der europäischen Literatur erlaubte es, sich selektiv zu bedienen. Besonderes Gewicht bei der Durchsetzung der Wald-Regen-Theorie kommt dem ersten wissenschaftlichen Gutachten zu, das unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung unter der Leitung von Ferdinand V. Hayden 1867 in Nebraska durchgeführt wurde. Hayden behauptet, daß sich die große Wüste (Great Desert) durch die voranschreitende Aufforstung der Siedler auf dem Rückzug befände. “It is believed [...] that the planting of ten or fifteen acres of forest-trees on each quarter-section will have the most important effect on the climate, equalizing and increasing the moisture and adding greatly to the fertility of the soil. The settlement of the country and the increase of timber has already changed for the better the climate of that portion of Nebraska lying along the Missouri, so that within the last twelve or fourteen years the rain has gradually increased in quantity and is more equally distributed through the year. I am confident that this change will continue to extend across the dry belt to the foot of the Rocky Mountains as the settlements extend and the forest-trees are planted in proper quantities.”[8] Das waren ermutigende Behauptungen, beglaubigt nicht nur von der Wissenschaft, sondern auch von der Regierung. Die problematische Einseitigkeit dieser Studie blieb unbeachtet angesichts des Bedürfnisses, alle Zweifel an der Garten-Eden-Utopie zu entkräften. Die Regierung wollte die Besiedlung, die als ein soziales Sicherheitsventil fungierte, weiter nach Westen vorantreiben, und die Eisenbahngesellschaften, wie die Kansas Pacific mußten ihre hohen Investitionen absichern. Akademiker, Verwaltungsbeamte und Politiker setzten sich in Nebraska für die Regen-Wald-Theorie ein. 1872 wurde in Nebraska der Arbor Day verkündet, der sich bald weltweit durchsetzen sollte. Eine breite Propagandaliteratur, die für die Rekrutierung von Einwanderern aus Europa warb, verbreitete alle möglichen Theorien, die die Gartenutopie stützten. “The old proverbial drought of the Far West,” so wurde dem Leser versichert, “is a thing of history. The causes which produced long seasons of draught in the early years, no longer exist.”[9] Es war der Vorstoß des Menschen selbst, der das Widrige überwand. Zivilisation schuf sich die Bedingungen ihrer Existenz durch ihre Durchsetzung. Dem Pflug wurde unter dem Slogan „Rain Follows the Plow“ ein ähnlicher Effekt wie dem Wald zugeschrieben. “Yet, in this miracle of progress, the plow was the avant courier - the unerring prophet - the procuring cause [...] in the sweat of his face, toiling with his hands man can persuade the heavens to yield their treasures of dew and rain upon the land he has chosen for a dwelling place.”[10] Eisenbahnschienen, elektrische Leitungen sowie Bewässerungsanlagen konnten das Wunder ebenso bewirken. Fortschrittsglauben wuchs sich zum Größenwahn aus – Wüsten und Trockenzonen wurden zu vorübergehenden Erscheinungen erklärt, die dem Fleiß und der Geschicklichkeit des Menschen zu weichen hatten.[11]
Doch nicht nur die Propagandaliteratur, die für die Besiedlung der Great Plains warb, stellte den Wald in den Dienst der Kultivierung. In Kalifornien und Australien unternimmt es zur selben Zeit eine umweltbewußte Elite, die sich für Kleinfarmen einsetzt, den Wald in das Zentrum ihrer Landschaftsreform zu rücken. Die Zerstörung der ursprünglichen Vegetation durch den großen Bedarf der Weidewirtschaft löst zunehmendes Umbehagen aus, ebenso die Schäden durch den Goldrausch in Kalifornien (1848) und in Victoria (1851) und in New South Wales (Australien) (1858). Auch an der äußersten Peripherie kolonialer Expansion - in Kalifornien und in Australien - wurde der Traum von einen Gartenparadies geträumt.[12] Verkehrsverbindungen und das vergleichbare Klima im Süden und Westen von Australien förderten einen intensiven Austausch mit Kalifornien. Um 1850 war Sydney schneller von San Francisco aus zu erreichen als New York. Güter, Pflanzen und Konzepte wurden zwischen den Kontinenten ausgetauscht. Akklimatisierungsgesellschaften und Botanische Gärten wurden zu zentralen Umschlagplätzen bei der Einführung neuer Pflanzen, besonders Bäumen. Akazien und verschiedene Variationen des Eukalyptusbaumes sollten helfen, die kalifornische Landschaft in einen subtropischen Garten zu verwandeln. In Australien erwies sich dagegen die aus Kalifornien eingeführte Pinus radiata als der erfolgreichste Baum. Südaustralien mit dem geringsten Waldbestand und der geringsten Niederschlagsmenge in den australischen Kolonien kam dem kalifornischen Klima am nächsten. Ein großer Teil des einheimischen Waldes war in Südaustralien um 1870 bereits der Landwirtschaft und dem Holzbedarf zum Opfer gefallen, so wurden hier Stimmen für ein Wiederaufforstungsprogramm zuerst laut. Ganz ähnlich wie in den Great Plains im amerikanischen Westen ging es auch hier um die Erweiterung der Grenzen für die Landwirtschaft, um die Sicherstellung von ausreichenden Niederschlägen. Zusammen mit dem Pflug sollte die Trockenzone im Norden von Südaustralien erschlossen werden. Bei John Ednie Brown, einem jungen Schotten, der das Jahr 1871-72 in den Vereinigten Staaten und Kanada verbracht hatte und 1878 zum Forstaufseher in Südaustralien ernannt wurde, finden wir gebündelt alle Konzepte wieder, die uns von Humboldt und Fraas bis in den amerikanischen Westen begleitet haben. Für die Reformer bestand eine enge Wechselbeziehung zwischen dem Menschen und der ihn umgebenden Landschaft, Aufstieg und Verfall von Kulturen entwickeln sich in enger Abhängigkeit von der Umwelt.[13] Die Zerstörung der Wälder in Asien und in den Mittelmeerländern gilt auch für Brown als warnendes Beispiel. “As our surroundings become physically more perfect, so in the same ratio do we become morally better. As one proof of this we have only to refer to the case of some of the ancient nations in Asia, such as Persia, Palestine, and Syria. [...] What is now the condition of these once fertile regions? It is this: their forests have been long ago destroyed; their fields are now [...] parched and unremunerative to the cultivators, and therefore agriculture is neglected, and their people have sunk into poverty and wretchedness; while the civilisation which once regulated their affairs has fallen with them, and left them in the condition of semi-barbarism in which they now are found.”[14] Mit dieser Erkenntnis öffnen sich nach seiner Ansicht weite Horizonte für eine blühende Landwirtschaft. Wohlüberlegte Pflanzungen von Bäumen werden das Klima von Südaustalien verändern und die Quantität und Qualität ihrer landwirtschaftlichen Produkte steigern und damit auch die allgemeine Industrie. Sein Vertrauen in die Effizienz der Aufforstung kennt keinerlei Vorbehalte. “Every tree planted in a country such as this is like a nail in the construction of a house - one step further towards unity of parts and general strength in one grand whole.”[15]
[1] Ralph Waldo Emerson: Nature. In: The Complete Works of Ralph Waldo Emerson, Vol. 1, Boston and New York 1903, S. 9f.
[2] The Works of Thoreau. Selected and edited by Henry Seidel Canby. Cambridge 1946, S. 668.
[3] Ebd., S. 669.
[4] Ebd., S. 675.
[5] Alexander von Humboldt: Views of Nature; or, Contemplations on the Sublime Phenomena of Creation. Trans. by E. C. Otte und H. G. Bohn. London 1896, S. 29ff. Vgl. David M. Emmons: Garden of the Grasslands. Boomer Literature of the Central Great Plains. Lincoln 1971, S. 7: “Von Humboldt and Guyot insisted that an American desert was geographically impossible, that the basic unity of the great concave interior basin between the Allegheny-Appalachian range and the Rockies ensured a similarity of form between prairies and plains.”
[6] Report of the Commissioner of Patents, Part II, Agriculture, 31st Cong., 1st sess., Sen. Ex. Doc. No. 15, 1849, S. 41.
[7] Daniel Lee: Agricultural Meteorology. In: U.S. Congress, House, Report of the Commissioner of Patents for 1850, 31st Cong., 1st sess., 1850, H. Ex. Doc. 243, pr. 2, S. 40f. Vgl. Michael Williams: Americans and their forests. A historical geography. Cambridge 1990, S. 381.
[8] Ferdinand V. Hayden: “Geology of Nebraska.” “Report of the Commission of the General Land Office,” 1867, in U. S. Department of the Interior Annual Report, 1867, 40th Cong., 3rd sess., H. Ex. Doc. 1 (Serial no. 1326), S. 159-60. Washington D.C.: GPO, 1867.
[9] Burlington: Nebraska, B & M Lands. Ohama 1880. Zitiert nach David M. Emmons: Garden of the Grasslands. Boomer Literature of the Central Great Plains. Lincoln 1971, S. 147.
[10] C. D. Wilber: The Great Valleys and Prairies of Nebraska and the Northwest. Omaha 1881, S. 70f.
[11] Ebd., S. 71.
[12] Vgl. Ian Tyrrell: True Gardens of the Gods. Californian-Australian Environmental Reform, 1860-1930. Berkeley, Los Angeles, London 1999.
[13] Vgl. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. In: Ders.: Ansichten der Natur. Hrsg. von Hanno Beck. Darmstadt 1987. S. 175-297. Humboldt schreibt S. 183: “Wer fühlt sich nicht, um selbst nur an nahe Gegenstände zu erinnern, anders gestimmt in dem dunklen Schatten der Buchen, auf Hügeln, die mit einzeln stehenden Tannen bekränzt sind, oder auf der Grasflur, wo der Wind in dem zitternden Laub der Birke säuselt? Melancholische, ernst erhebende oder fröhliche Bilder rufen diese vaterländischen Pflanzengestalten in uns hervor. Der Einfluß der physischen Welt auf die moralische, das geheimnisvolle Ineinanderwirken des Sinnlichen und Außersinnlichen gibt dem Naturstudium, wenn man es zu höheren Gesichtspunkten erhebt, einen eigenen, noch zu wenig erkannten Reiz.”
[14] J. E. Brown: A Practical Treatise on Tree Culture in South Australia. Adelaide 1881, S. VII.
[15] Ebd. S. 9.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>