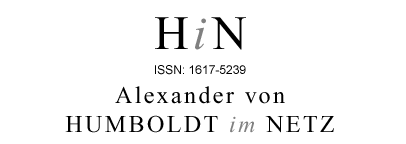
|
Archivkopie der Website http://www.humboldt-im-netz.de |
|---|
______________________________________________________
Engelhard Weigl
Wald und Klima: Ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert
4. Vom ökologischen Selbstmord im Mittelmeerraum zum ökologischen Selbstmord der Erde
Die Historisierung der Natur, die durch Roussau eingeleitet wurde, geht keineswegs, wie Lepenies für das 19. Jahrhundert festgestellt hat, in allen Disziplinen mit einer Entmoralisierung der Wissenschaft zusammen, ganz im Gegenteil, mit der Dynamisierung des Naturbegriffs ist eine Verschärfung des Krisenbewußtsein verbunden.[1] Die Entdeckung, daß die Erde eine Geschichte hat, wird nun auch für die Erdoberfläche, für die Vegetationsschicht auf ihr entdeckt. Zu der Entmoralisierung der Naturwissenschaften läßt sich zumindest eine Gegenströmung ausmachen, die einen engen Zusammenhang zwischen dem Tun des Menschen und den Katastrophen der Natur wahrzunehmen in der Lage ist. In Deutschland und Italien, aber besonders in Frankreich wuchs eine breite Literatur, die die durch den Menschen verursachten Umweltschäden ausführlich behandelte. 1864 schreibt Marsh: “The literature of the forest, which in England and America has not yet become sufficiently extensive to be known as a special branch of authorship, counts its thousands of volumes in Germany, Italy, and France. It is in the latter country, perhaps, that the relations of the woods to the regular drainage to the soil, and especially to the permanence of the natural configuration of terrestrial surface, have been most thoroughly investigated. On the other hand, the purely economical aspects of sylviculture have been most satisfactorily expounded, and that art has been most philosophically discussed, and most skilful and successfuly practised in Germany.”[2] Humboldt ist durch seine enge Zusammenarbeit mit französischen und schweizer Wissenschaftlern und durch seine Ausbildung in den Kameralwissenschaften in Deutschland mit beiden Traditionen bestens vertraut. Neben den Beiträgen der Forstwissenschaft gehen von der Physischen Geographie in der Nachfolge Alexander von Humboldts entscheidende Impulse bei der Wahrnehmung problematischer Nebeneffekte fortschreitender Naturbeherrschung aus. Am Beispiel von zwei Autoren, Carl Fraas (1810-1875) und George P. Marsh (1801-1882), soll gezeigt werden, wie durch die Historisierung und Verräumlichung der Biologie, die Humboldt durch seine Geographie der Pflanzen eingeleitet hatte, sich ein Bewußtsein von der Zerstörbarkeit der Erde durch den Menschen herausbilden konnte. Fraas wie auch Marsh beziehen sich dabei kritisch auf Humboldt, der die Natur noch zu statisch gesehen und dabei den Einfluß des Menschen auf die Veränderung der Erdoberfläche und des Klimas unterschätz habe.[3] Beide argumentieren jedoch im Rahmen seines Paradigmas. Marsh geht noch einen Schritt weiter als Fraas und kehrt explizit die Humboldtsche Fragestellung um: “The labors of Humboldt, of Ritter, of Guyot, and their followers have given to science of geography a more philosophical, and, at the same time, a more imaginative character than it had received from the hands of their predecessors. Perhaps the most interesting field of speculation, thrown open by the new school to the cultivators of this attractive study, is the inquiry: how far external physical conditions [...] have influenced the social live and social progress of man. [...] But, as we have seen, man has reacted upon organized and inorganic nature, and thereby modified, if not determined, the material structure of his earthly home.”[4] Beide, Fraas und Marsh, gewinnen ihre Einsicht in das destruktive Potential des Menschen durch eine neue Wahrnehmung der Mittelmeerlandschaft. „Alles was den Reisenden, der von Norden über die Alpen steigt, wie eine neue Welt anmuthet, die Plastik und stille Schönheit der Vegetation, die Charakterformen der Landschaft,“[5] das, was nach Vergil und Goethe auch noch die Touristen von heute begeistert, wurde unter einem neuen kritischen Blick als ruinierte Landschaft entdeckt, als Opfer jahrtausendealter Kultur, die mit den Wäldern die Böden und den Wasserhaushalt zerstörte. Carl Fraas, der 1835 als Erzieher nach Athen ging, dort Direktor der Kgl. Gärten und erster Professor der Botanik an der neu errichteten Universität wurde und 1842 wieder nach Deutschland zurückkehrte, machte die These von dem Niedergang des Bodens und der Vegetation seit der klassischen Antike zur herrschenden Lehre. Marsh, der sich als amerikanischer Botschafter von 1849 bis 1853 in der Türkei, und dann von 1861 bis zu seinem Tode 1882 in Italien aufhielt, folgte der These von Fraas, die heute noch kontrovers diskutiert wird.[6] Was hat ein Land wie Griechenland oder auch das Römische Reich, die über eindrucksvolle Wälder und weite fruchtbare Felder verfügten, in den armseligen Zustand verwandelt, in dem sie sich heute befinden, woher kommen die ausgedörrten Wüstenregionen, die heute das Mittelmeer umgeben, fragt Marsh ebenso wie Fraas. Die „Veränderungen der organischen Natur in der Zeit“[7], die Wanderungsbewegung von Baumsorten wie der Feige und dem Ölbaum von Osten nach Westen, wird von Fraas als Indikator eines sich kaum merkbar verändernden Klimas gelesen, das wiederum ausgelöst wird durch die Bearbeitung der Erdoberfläche durch den Menschen. Humboldts und Moreau de Jonnès Ausführungen über den Einfluß des Waldes auf die Luftfeuchtigkeit und Temperatur einer Region wird von Fraas bis weit in die Vergangenheit projiziert und von dort wiederum in die nahe Zukunft extrapoliert. Es ist die „Entholzung“ eines Landes, die zur Bodenerosion, zur Erhöhung der bodennahen Wärme und zur Niederschlagsarmut führt.[8] Desertifikation ist die irreversible Tendenz, die sich mit der ausbreitenden Zivilisation von Persien, Mesopotanien, Palästina, Ägypten, Griechenland bis Italien ausbreitet. Von dort aus verdüstert sich auch die Zukunft Europas, denn „[c]ivilisirte stark bevölkerte Staaten brauchen nothwendig jenen die Natur eben so sehr verletzenden Schmuck an Wiese und Wald, brauchen Ackerfelder statt Wälder, trocknen Sümpfe und Moore aus, brennen den feuchtigkeitshaltenden Torf und die Wälder, kurz, können ohne solche suppedimente nicht das werden, was sie sind.“[9] Die Zukunft ist für Fraas noch nicht entschieden, aber schwer lastet auch „Ungewißheit“ über Zentraleuropa.[10]
Victor Hehn, der das Projekt einer Geschichte der Flora und Fauna des Mittelmeerraumes von Carl Fraas noch einmal aufgreift und eine Kulturgeschichte der domestizierten Pflanzen und Tiere schreibt, setzt sich ausführlich mit den wissenschaftlichen und philosophischen Voraussetzungen von Fraas auseinander. Die heutige Vegetation Griechenlands und Italiens - Oliven, Weinstöcke, Feigenbäume, Pinien und Zypressen – wird als Importgut, als Ergebnis einer vom östlichen Mittelmeerraum ausgehenden Kulturwanderung gedeutet, nicht als Indikator eines Klimawandels, sondern als das Werk des bebauenden, pflegenden, veredelnden Menschen. Auch Hehn kannte Griechenland und Italien aus eigener Anschauung, mehrere Bücher hat er der italienischen Landschaft gewidmet.[11] Doch als Hegelianer und Verehrer Goethes steht er der ästhetischen Tradition der Weimarer Klassik näher als der Romantik mit ihrer Sehnsucht nach den dunklen Wäldern der Vergangenheit. Er durchschaut den kulturfeindlichen Hintergrund der Verfallstheorien, die Zivilisation und Natur auf einem Kollisionskurs zulaufen lassen, der keine Korrekturen mehr erlaubt. „Historische Mystiker“ nennt er die Theoretiker, die „nichts als Verderbnis, Ausnutzung, versiegte Lebenskraft“ im Zivilisationsprozeß entdecken. „Waldzerstörung ist eine Phase, aber nicht das letzte Wort der Kultur.“[12] Dem heroischen Akt des Ausrodens, der „Licht und Kultur“ schuf, Boden für Kräuter und Fruchtbäume, folgen Gegenmaßnahmen, die den Bestand des Waldes innerhalb gewisser Grenzen sichern. Hehn sieht hier eine pessimistische Geschichtsphilosophie am Werk, nicht eine sorgfältige naturwissenschaftliche Analyse.[13] Auch das so beliebte Klimaargument ist ihm nicht frei von Romantizismus und der Verteidigung handfester partikularer Interessen: „Man überschätze auch nicht den Einfluß der Wälder auf das Klima. Es ist damit gegangen, wie oft mit neuen Gesichtspunkten: Man pflegt sie allzu ausschließlich geltend zu machen. In dem vorliegenden Falle kam noch das Interesse der poetischen Gemüther und besonders das des feudalen Adels hinzu, der für größere Besitzstücke kämpfte, sein Jagdrevier nicht missen wollte und diesmal glücklich war, mit den neuen Lehren der Bodenwirthschaft und Nationalökonomie Chorus machen zu können.“[14] Doch Hehn deckt nicht nur die Interessen auf, die der Klimaargumentation eine so breite Resonanz verschaffen, er sieht auch die wissenschaftlichen Grenzen dieser meteorologischen Theorie, die die regionalen Einflußfaktoren überbewertet und dabei die globale meteorologische Dynamik vernachlässigt. „Landscape Meteorology“ hat man dieses Konzept genannt, weil in ihm bestimmte Merkmale der Landschaft in einem Zusammenhang mit der Entwicklung des Wetters und des Klimas gebracht werden. Dieses Konzept, das dem Einfluß von Wäldern und Vegetation, Kultivierung, der Entwässerung von Sümpfen und der Begradigung von Flüssen großes Gewicht zumißt, setzt sich dem Vorwurf aus, den globalen Luftbewegungen über dem Meer und den Kontinenten und ihrer Interaktion zu wenig Beachtung zu schenken.[15] Diese Einsicht moderner Meteorologie nimmt Hehn bereits vorweg: „In der That aber hängen die klimatischen und Witterungsverhältnisse der europäischen Länder im Grossen gar nicht von der Pflanzendecke des Bodens ab, sondern nächst der geographischen Breite von weitgreifenden meteorologischen Vorgängen, die von Afrika und dem atlantischen Ocean bis zum Aralsee und Sibirien reichen.“[16] Hehn sieht die zivilisationskritische Klimatheorie im Kontext anderer Erschöpfungstheorien, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts Beunruhigung auslösten. Die Wissenschaft der Agrikultur und Bodenchemie macht ebenfalls für die Mittelmeerländer auf die über Jahrhunderte, ja Jahrtausende fortgesetzte Auslaugung des Bodens durch die Landwirtschaft aufmerksam, ein Schicksal, das mit einer gewissen Zeitverzögerung der ganzen Erde droht.[17] Auch die Begrenztheit der Kohlen- und Erzvorräte kommt auf dem ersten Höhepunkt des Industrialisierungsprozesses zum Bewußtsein. Hehn kann sich in seinem Vertrauen auf die kulturellen Leistungen die bedrohlichen Szenarien der Wissenschaft noch durch den Hinweis auf die zyklische Struktur der Naturprozesse und die Langsamkeit ihrer Erschöpfung vom Leibe halten. Aber das Gespenst des Wärmetodes taucht bei ihm zur selben Zeit wie die Entdeckung des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik und des damit verbundenen Konzepts der „Entropie“ auf.[18] Die Auflösung von Differenzen zugunsten eines vergleichgültigten Gleichgewichtszustands wurde als unausweichliches und irreversibles Schicksal einer thermodynamisch begriffenen Welt erkannt, die von sich aus zu einem indifferenten und spannungslosen Zustand tendiert, in dem sich nichts mehr ereignen kann. „Und was der Mensch durch seine Nutzung nur beschleunigt, das muss auch auf dem Wege des natürlichen Pflanzenlebens, auch wenn es nie einen Menschen gegeben hätte, als letzte Folge sich ergeben. Dann wird auch, setzen wir noch hinzu, alles Gebirge auf Erden durch die Kraft des Wassers und Winde und der Verwitterung geebnet sein und die Sonne, die immerfort Wärme abgiebt, ohne dass ihr die verlorene durch irgend Etwas, so viel wir wissen, ersetzt wird, todt und kalt sein und mit ihr die Erde und der Mensch.“[19]
Die Welt wurde in der Physik, aber auch in den biologischen Wissenschaften und der ihr nahestehenden Physischen Geographie nicht mehr als ein ewig laufendes Uhrwerk vorgestellt, in dem sich einzelne Elemente reversibel von Punkt A zu Punkt B bewegen, sondern als ein System, dessen Wirkungen sich irreversibel im Fluß der Zeit aufbrauchen. Es ist für Marsh nicht die Dominanz des seßhaften Menschen allein, die einen Paradigmenwechsel der Physischen Geographie erfordert. Die Eingriffe des Menschen haben einen anderen Charakter angenommen als die Erdbeben, Vulkanausbrüche, Blitzschläge und Stürme, „being only phenomena of decomposition and recomposition.“[20] Die destruktive Gewalt des Menschen fügt der Natur dagegen irreparable Schäden zu, die ihre selbstheilenden Mechanismen treffen. Der Blick auf die Alte Welt offenbarte für den amerikanischen Diplomaten nicht nur eine Ehrfurcht erheischende jahrhundertealte Kultur, sondern auch einen erschöpften, entkräfteten und verschlissenen Teil des Planeten. Hunderte von Generationen haben durch ihre beharrliche Arbeit den Boden ausgelaugt. Die Zeichen sind für Marsh klar. Es sind immer dieselben Ursachen des Niedergangs, die auf den Fall einer Zivilisation deuten: Ausrottung der Wälder und Tierwelt, Überweidung und eine den Boden erschöpfende Kultivierung. Der unfruchtbare Sand der Sahara, die adriatische Verkarstung und auch die durch Sturzfluten verheerten Alpenvorländer zeugen von derselben menschlichen destruktiven Unachtsamkeit, die zuerst immer wieder den Wäldern gilt. Eine Stimmung des Fin de siècle verbreitete sich in Europa, das mit dem Abnehmen der wichtigsten Ressource, und das war vor der Industrialisierung, neben dem Wasser, der Wald, den Bestand der Welt selbst in Gefahr glaubte.
Marsh hatte in seinem Buch „Man and Nature“ das Verhältnis von Wald und Klima mit großer Ausführlichkeit behandelt, aber trotz der verbreiteten Überzeugung, daß Wälder die Niederschlagsmenge erhöhen, zur Vorsicht geneigt. Zu unsicher schien ihm die Datenlage und überhaupt die Leistungsfähigkeit der Physischen Geographie im Bereich der Klimatologie.[21] Marsh Zurückhaltung ist aber eher eine Ausnahme. Trotz vorhandener Gegenstimmen, erreicht die Flut der alarmierenden Untersuchungen in den 70er Jahren einen Höhepunkt. Aus dem Sinken der Wasserstände einiger europäischer Flüsse schloß G. Wex, „auf eine continuirliche Minderung der Regenmenge in den Culturländern [...]“[22]. Wex wagt sogar ein allgemeines Gesetz zu formulieren: „In den Culturländern findet eine continuirliche Abnahme des Wassers in den Quellen, Flüssen und Strömen statt, verursacht in erster Linie durch zunehmende Entwaldung und die hierdurch bedingte Minderung des Regenfalls.“[23] Der schottische Botaniker John Croumbie Brown versucht nach zwei harten Trockenperioden in Südafrika 1847 und 1862 den zerstörerischen Umgang mit der ursprünglichen Vegetation mit dem Hinweis auf den positiven Einfluß der Wälder auf das Klima aufzuhalten. Beständige Kronzeugen seiner Naturschutzpolitik waren dabei die Arbeiten von Humboldt und Boussingault.[24] Doch auch aus Indien,[25] Ägypten und Australien treffen beunruhigende Berichte über zunehmende Dürren ein. 1870 bemüht sich der Direktor des Botanischen Gartens in Adelaide Richard Schomburgk, ein enger Vertrauter Humboldts, nach den katastrophalen Dürreerfahrungen 1865 um ein groß angelegtes Wiederaufforstungsprogramm in Südaustralien.[26] Ferdinand von Müller, der bedeutendste Botaniker Australiens, Direktor des Botanischen Gartens in Melbourne (Australien) schreibt 1872 einen kritischen Bericht über die rücksichtslose Entwaldung Australiens, die alle Warnungen über den Verlust der in heißen Regionen so dringend benötigten ausgleichenden Kraft des Waldes auf Klima und Wasserhaushalt des Bodens in den Wind schlägt.[27]
Die Befürchtungen der Wissenschaftler lassen sich – wie Glacken schreibt – in einem Satz zusammenfassen: Zivilisation führt zur Dürre,[28] oder wie es ein populärer Autor ausdrückt: „Der Mensch schreitet über die Erde und ihm folgt die Wüste.“[29]
[1] Wolf Lepenies: Historisierung der Natur und Entmoralisierung der Wissenschaften seit dem 18. Jahrhundert. In: Ders.: Gefährliche Wahlverwandschaften. Essays zur Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart 1989, S. 7-38.
[2] Marsh: Man and Nature, a.a.O., S. 217f.
[3] Carl Fraas: Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, ein Beitrag zur Geschichte beider. Landshut 1847, S. 1 und S. 3: “Humboldt und mit ihm viele angesehene Männer betrachten die Einflüsse, welche der Mensch oder vielmehr seine Civilisation auf das Klima ausüben, für geringfügig - “
[4] Marsh: Man and Nature, a. a. O., S. 8.
[5] Victor Hehn: Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch-linguistische Skizzen. Berlin 1870, S. 1.
[6] Vgl. zu aktuellen Diskussion Radkau: Natur und Macht, a.a. O., S. 160-164: “Entwaldung und “ökologischer Selbstmord” im Mittelmeerraum: Ein Scheinproblem?”
[7] Fraas: Klima und Pflanzenwelt, a.a. O., S. 5.
[8] Ebd., S. 10.
[9] Ebd., S. 136.
[10] Ebd., S. 137.
[11] Victor Hehn: Italien. Über die Physiognomie der italienischen Landschaft (1844); Ders.: Italien. Ansichten und Streiflichter (1867); Ders.: Reisebilder aus Italien und Frankreich (1894).
[12] Victor Hehn: Kulturpflanzen und Hausthiere, a.a. O., S. 3 und 4.
[13] Ebd., S. 7.
[14] Ebd., S. 6f.
[15] Vgl. Walter and Johanna Kollmorgen: Landscape Meteorology in the Plains Area. In: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 63, No. 4 (Dec., 1973), S. 424-441.
[16] Victor Hehn: Kulturpflanzen, a.a.O., S. 7.
[17] Carl Fraas: Bavaria rediviva, ein Beitrag zur Lehre von Völkeruntergang durch Bodenerschöpfung. 1870.
[18] Rudolf Clausius, Pogg. Ann. Phys. 125 (1865).
[19] Victor Hehn: Kulturpflanzen, a.a.O., S. 9.
[20] Marsh: Man and Nature, a.a. O., S. 35.
[21] Ebd., S. 22ff.
[22] G. Wex: Über die Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen und Strömen. In: Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins. 1874. Zitiert nach: Eduard Brückner: Klimaschwankungen seit 1700, a.a. O., S. 18.
[23] Ebd., S. 19. Zu dem gleichen Resultat kommt M. W. Schmidt: Wasserstandsbeobachtungen an der Elbe im Königreich Sachsen. Leipzig 1878, S. 559. Für das 19. Jahrhundert können in der Tat für Mitteleuropa eine größere Zahl von trockenen Extremjahren nachgewiesen werden. Vgl. Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. Darmstadt 2001, S. 180f.
[24] John Croumbie Brown: Forests and Moisture; or Effects of Forests on Humiditiy of Climate. Edinburgh, London 1877; ders.: Pine Plantation on the Sand-Wastes of France. Edinburgh, London 1878. Vgl. Richard Grove: Early themes in African conservation: the Cape in the nineteenth century. In: D. Anderson and R.H. Grove (Hrsg.): Conservation in Africa: People, policies and practices. Cambridge 1987, S. 33: “The basic scientific literature was cited and the report drew special attention to the work of Humboldt and Boussingault, the two men whose warnings of the possible climatic effects of deforestation had first attracted the notice of East Indian Company Surgeons Alexander Gibson and Eduard Balfour, and then been assiduously cultivated (and, it must be said, somewhat coloured, exaggerated and simplified by Pappe and Brown for their own concervation propaganda purposes.”
[25] Richard Grove, Vinita Damodaran, Satpal Sangwan (Ed.): Nature and the Orient. The Environmental History of South and Southeast Asia. Delhi 1998.
[26] Richard Schomburgk: Influence of Forest on Climate. In: Ders.: Papers read before the Philosophical Society and the Camber of Manufactures. Adelaide 1873, S. 1-7. Vgl. E. Weigl: Acclimatization. The Schomburgk Brothers in Southaustralia. In: HiN. Alexander von Humboldt im Netz. IV, 7 (2003) http://www.uni-potsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin/hin7
Go to article | Engelhard Weigl in HiN 7
[27] Ferdinand von Mueller: Forestry. In: The Journal of applied Science 1872, Vol. 3, S. 198-202.
[28] Clarence J. Glacken: Changing Ideas of the Habitable World. In: William L. Thomas jr. (Hrsg.): Man´s Role in Changing the Face of the Earth. New York 1956, S. 92.
[29] Simony: Schutz dem Walde! Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. LXX. 1876/78. Wien 1877. S. 425. Zitiert nach Brückner: Klimaschwankungen, a.a. O., S. 13.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>