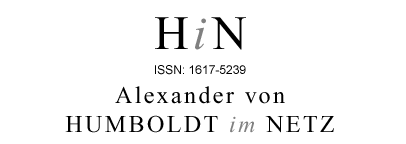
|
Archivkopie der Website http://www.humboldt-im-netz.de |
|---|
______________________________________________________
Engelhard Weigl
Wald und Klima: Ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert
6. Das Ende eines Mythos
Der Zusammenbruch des Wald-Klima-Mythos am Ende des 19. Jahrhunderts hat vielfältige Ursachen. Trockenheiten in Amerika, zuerst in der Mitte der 70er Jahre, dann um 1885 ließen die Zweifel an der Theorie wachsen, doch 1893 wurden die Bedingungen so schlecht, daß eine regelrechte Panik ausbrach, und Tausende von Farmern ihr Land fluchtartig verließen.[1] Mit der Erhöhung der wissenschaftlichen Maßstäbe für die meteorologischen Untersuchungen wuchs die Skepsis. Eduard Brückner schreibt 1890 über die Wald-Klima Diskussion wie über eine ferne Epoche. „Fast wie ein psychologisches Räthsel erscheint es uns, dass auf Schritt und Tritt für ein und dasselbe Land von ernsten Männern der Wissenschaft Änderungen des Klimas behauptet werden, die einander ausschließen, nicht minder ein psychologisches Räthsel, wie für die verschiedenartigsten und oft entgegengesetzten Änderungen immer wieder und immer wieder der Wald als Sündenbock bezeichnet wird, der alle Schuld tragen soll.“[2] Ende des 19. Jahrhunderts bricht das Paradigma, Humboldts Physik der Erde („Physique du monde“), das den Mythos vom Wald als Klimafaktor getragen hatte, endgültig zusammen. Die Wissenschaft vom Klima etabliert sich als eigenständige Fachwissenschaft und wird immer stärker als Teil der Physik verstanden. Mit der Lösung von der traditionellen Bindung an die Geographie, mit der quantitativen Beschreibung des Klimas auf der Basis der instrumentellen Bestimmung von Klimavariablen ging aber auch der Wissenschaft die Einsicht in die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt verloren. Die Erforschung der Auswirkungen des Klimas auf die Biosphäre und auf den Menschen trat ebenso in den Hintergrund wie die Frage nach den Folgen menschlichen Handelns auf das Klima. Zu Beginn der Umweltdebatte in den USA 1956 heißt es noch: “I have stated that man is incapable of making any significant change in the climate pattern on the earth; that the changes in microclimate for which he is responsible are so local and some so trivial that special instruments are often required to detect them.”[3] Daß dies nicht das letzte Wort in der Debatte ist, haben wir in den letzten Jahren gründlich erfahren. Aber nicht nur die wissenschaftlichen Voraussetzungen der Debatte haben sich seit dem 19. Jahrhundert grundlegend geändert, sondern auch der Fokus hat sich gewandelt: Vom Wasserhaushalt der Erde zum „Global Warming“. Die Anschaulichkeit der „Physique du monde“ Humboldts gehört heute ebenso der Vergangenheit an wie ihr Totalitätsanspruch.
[1] Charles R. Kutzleb: American Myth, Desert to Eden: Can Forests Bring Rain to the Plains? In: Forest History 15 (1971), S. 20f.
[2] Eduard Brückner: Klimaschwankungen seit 1700, a.a. O., S. 34f.
[3] C. W. Thornthwaite: Modification of Rural Microclimates. In: William L. Thomas jr. (Hrsg.): Man´s Role in Changing the Face of the Earth. New York 1956, S. 582.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht