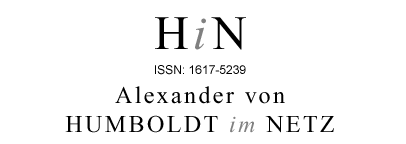
|
Archivkopie der Website http://www.humboldt-im-netz.de |
|---|
______________________________________________________
Engelhard Weigl
Wald und Klima: Ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert
3. Der Wald als ursprüngliche Natur
Humboldt war, auch wenn er zuerst als Student der Kameralwissenschaften und als Oberbergmeister in Franken auf das Problem der Holzknappheit aufmerksam gemacht wurde, mit seiner Vorstellung von der Natur als einer empfindlichen Harmonie der französischen Tradition verpflichtet. Bernardin de St. Pierre, ein Gefolgsmann Rousseaus, dessen „Études de la Nature“ und „Harmonies de la Nature“ in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts erscheinen, gehört zu Humboldts Lieblingsautoren. Sein Roman „Paul et Virginie“ begleitet ihn auf seiner Amerika-Expedition. „’Paul und Virginia’,“ schreibt Humboldt im „Kosmos“, „ein Werk, wie es kaum eine andere Literatur aufzuweisen hat, ist das einfache Naturbild einer Insel mitten im tropischen Meer, wo, bald von der Milde des Himmels beschirmt, bald vom mächtigen Kampf der Elemente bedroht, zwei anmutvolle Gestalten in der wilden Pflanzenfülle des Waldes sich malerisch wie von einem blütenreichen Teppich abheben.“[1] Beeinflußt von Bernhardin de St. Pierre erscheint 1802 das zweibändige Werk des französischen Ingenieurs F. A. Rauch „Harmonie hydro-végétale et météorologique“, in der zweiten Auflage 1818 dann unter dem Titel „Régéneration de la nature végétale“. Rauchs leidenschaftliche Anklage gegen die Waldzerstörung verbindet sich mit der Aufforderung an den Menschen, sich wieder einzugliedern in die Harmonien der Natur. Gerade weil in der Natur eine ursprüngliche, universale, nach allen Richtungen hin ausbalancierte Harmonie besteht, muß der Eingriff des Menschen zwangsläufig eine Kette von destruktiven Veränderungen nach sich ziehen. Weil die Natur vollkommen ist, kann der Mensch nichts an ihr ändern, ohne ihre Vollkommenheit zu gefährden.[2] Für Rauch ist der Wald das Reich der ursprünglichen Natur. Wie bei Humboldt und Boussingault, stehen bei der Verteidigung des Waldes auch bei Rauch negative Klimaveränderungen als Folgeerscheinung von Waldvernichtung im Mittelpunkt. Dem Buch von Rauch folgt 1825 die Preisschrift der Akademie von Brüssel von Moreau de Jonnès, die so erfolgreich ist, daß sie auch ins Deutsche übersetzt wird.[3] Auch er widmet der Klimafrage breiten Raum. Ähnliche Stimmen sind auch in Deutschland vernehmbar, wenn auch eher am Rande. 1815 erscheint Ernst Moritz Arndts Aufsatz “Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forsten und der Bauern”.[4] Arndt, der seine Abhandlung mit Rousseau eröffnet, erweitert den alten Gedanken, daß die Umwelt den Menschen formt, in ein enges Wechselverhältnis zwischen äußerer Natur und der Natur des Menschen. Eine zerstörte, häßliche Natur bringt auch zerstörte Menschen hervor, verkrüppelt an Leib und Seele. „Der Mensch und die Natur machen einander gegenseitig.“[5] Der Schutz des Waldes wird nicht mehr von den Bedürfnissen der Holzversorgung abhängig gemacht, sondern an ihm hängt Blüte oder Niedergang der Kultur eines Volkes. Die Axt, „die an einen Baum gelegt wird“, wird „häufig zu einer Axt, die an das ganze Volk gelegt wird.“[6] Ein romantischer Baumkult, der sich der germanischen Götterverehrung in den Wäldern nahe fühlt, geht zusammen mit genauen Beobachtungen der Funktionen des Waldes im Wasserhaushalt der Natur, sein Einfluß auf das Klima, die Fruchtbarkeit der Felder, sein Schutz vor dem Wind und der Bodenerosion. Die Zerstörung der großen Wälder in Deutschland würde, da ist Arndt sich sicher, „plötzlich ein anderes Klima [hervorbringen] und bald auch ein anderes schlechteres und schwächeres und ungöttlicheres Volk, als die Teutschen jetzt noch sind. Nämlich weniger Regen und Naß des Himmels, bald manches Land dürrer und unfruchtbarer, viele Quellen und Bergströme würden in wenigen Jahren nicht mehr genannt werden, selbst die herrlichsten Fürsten der Ströme, der Rhein und die Donau, würden mit weniger Wasser brausen.“[7]
[1] Alexander von Humboldt: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Teilband 2, hrsg. von Hanno Beck. Darmstadt 1993, S. 58f.
[2] F. A. Rauch: Régéneration de la nature végétale. 1. Bd. Paris 1818, S. 42.
[3] Alexandre Moreau de Jonnès: Primiere mémoire eu réponse à la question proposée par l’Académie royale de Bruxelles: Quels sont le déboisement de forets considerables sur contrées et communes adjacents [...]. Bruxelles 1825. [Ders.]: Untersuchungen über die Veränderungen, die durch die Ausrottung der Wälder in dem physischen Zustand der Länder entstehen. Tübingen 1828.
[4] 1820 erscheint der Aufsatz in Buchform: Ernst Moritz Arndt: Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forsten und Bauern im Sinne einer höheren d.h. menschlichen Gesetzgebung. Schleswig 1820.
[5] Ebd., S. 33.
[6] Ebd., S. 50.
[7] Ebd., S. 55.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>