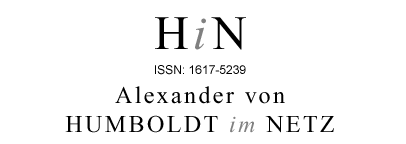
|
Archivkopie der Website http://www.humboldt-im-netz.de |
|---|
______________________________________________________
Engelhard Weigl
Wald und Klima: Ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert
2. Störungen der Harmonie der Natur
Als Alexander von Humboldt am 16. Juli 1799 in Cumaná in Südamerika landete, ging es ihm um die Erforschung der Bedingungen des Lebens auf der Erde. Die Untersuchung des Klimas in seiner Genese und in seinem Zustand durch bestimmte geophysikalische und atmosphärische Prozesse hatte dabei im Rahmen seines Wissenschaftskonzepts, seiner „Physique du monde“, einen zentralen Stellenwert. Mit den Mitteln der neuesten wissenschaftlichen Meßinstrumente und Theorien ging es ihm um die Beantwortung der seit der Antike erörterten Frage nach den Einwirkungen von Klima, Standort oder Bodenbeschaffenheit auf die Entwicklung der Flora und Fauna und letztendlich auch auf das Wesen und das physische Wohlbefinden des Menschen. Doch das als jungfräulich angesehene Amerika öffnete ihm - wie vielen Beobachtern vor ihm von Columbus bis Comte de Volney und Jefferson[1] - die Augen für den Einfluß des Menschen auf seine Umwelt. Bereits auf seiner ersten Exkursion von Cumaná zu der berühmten Guácharo-Höhle bei Caripe im September 1799 bewundert Humboldt nicht nur die Großartigkeit und Vielfalt der Tropennatur, er registriert auch den Effekt großer Waldrodungen auf den Wasserhaushalt der Region: „[...] vielleicht ein Hauptgrund der seit fünf Jahren so zunehmenden Dürre und des Vertrocknens der Quellen in der Provinz Neu-Andalusiens.“[2] Sorgfältig sucht Humboldt nach den regionalen Ursachen für die langanhaltende Dürre, die die nördlichen Provinzen von Venezuela plagt. Richtung und Gestalt der Gebirgszüge, Flüsse, Entfernung und Gestalt der Meeresküste werden dabei erörtert, doch ein Stichwort ragt unter den genannten Faktoren heraus: „Wald sehr ausgerottet.“[3] Es verwundert deshalb nicht, daß Humboldt die Antwort schnell parat hat, als ihn die beunruhigten Anwohner des Sees von Valencia nach den Ursachen für das Sinken des Wasserspiegels befragten. „Seit 60 Jahren und besonders seit den letzten 20 Jahren Abnahme genau beobachtet und Geschrei erregend. Gewiß auch Abnahme stärker aus zwei Ursachen. Kultur hat seitdem zugenommen.”[4] Die Ableitung der Flüsse für die Bewässerung der intensiven Plantagenwirtschaft – Zuckerrohr, Indigo und Baumwolle – wird von Humboldt als ein Faktor für das Sinken des Wasserspiegels zwar erwähnt, aber es geht ihm in erster Linie um etwas anderes: „[...] mehr noch, diese Flüsse selbst sind jetzt wasserärmer. Die umliegenden Gebirge sind abgeholzt. Das Gebüsch (monte) fehlt, um die Wasserdünste anzuziehen und den Boden, der sich mit Wasser getränkt, vor schneller Verdampfung zu schützen. Wie die Sonne überall frei Verdampfung erregt, können sich nicht Quellen bilden. Unbegreiflich, daß man im heißen, im Winter wasserarmen Amerika so wüthig als in Franken abholzt (desmonta) und Holz- und Wassermangel zugleich erregt.“[5]
Von den möglichen Faktoren für den sinkenden Wasserstand – langanhaltende Dürre, Reduzierung des zufließenden Wassers von Flüssen und Bächen durch Bewässerungsanlagen oder durch die vollständige Umleitung von Flüssen, unterirdischer Wasserabfluß – wird von Humboldt nur die Waldrodung breit diskutiert. Einen unterirdischen Abfluß schließt Humboldt und später Boussingault vollständig aus. „Einige sich Klugdünkende Einwohner haben eine künstliche, alberne Theorie von einem Loche verbreitet, durch welches (mittelst unterirdischer Kommunikation) die Wasser der Laguna dem Meere zufließen. Aber welche Wahrscheinlichkeit zu diesem Loch und wozu, da man solcher Hypothesen gar nicht bedarf.“[6] Aber gerade diese letzte Hypothese wurde von Wissenschaftlern 1962 als eine Ursache für die unausgeglichene Wasserbilanz des Sees nachgewiesen. Sie haben einen unterirdischen Abfluß von 3,4 m3/pro Sekunde berechnet.[7] Damit ist Humboldts Hypothese noch nicht gänzlich entwertet, aber sie erfährt eine wichtige Relativierung.
Humboldts enzyklopädisches Projekt einer „Physique du monde“ oder „Théorie de la terre“ ist einerseits getragen von der Überzeugung, daß nur ein strenger Empirismus, der sich theoretischer Annahmen möglichst weitgehend enthält, zur wissenschaftlichen Erklärung komplexer Naturphänomene führen kann. Vor der Gefahr dieses strengen Positivismus, der ihm die Welt in unzusammenhängende Daten zerfallen lassen könnte, bewahrt ihn die Annahme, daß die Dynamik der verschiedenen Kräfte im geschichtlichen Prozeß in ein Gleichgewicht überführt wird, wie dies in idealer Form Pierre-Simon de Laplace für die Bewegung der Gestirne in seinem „Traité de mécanique céleste“ (1799-1825) vorgeführt hat. So bestimmt Humboldt einerseits genau die Lage des Sees, die Temperatur und die Tiefe des Wassers und die Luftfeuchtigkeit, unternimmt später ausführliche Experimente über die hohe Verdunstungsrate des Wassers unter tropischen Bedingungen,[8] beobachtet die Wasserführung der verschiedenen Flüsse, stellt Vergleiche mit anderen Regionen an, unterstellt aber andererseits klar eine Tendenz der Natur, die verschiedenen Kräfte in ein Gleichgewicht zu bringen. Wie die Lage der Gebirge, periodische Dürren, die Sonneneinstrahlung, die Winde, die Luftfeuchtigkeit und die Vegetation auf den Wasserstand des Sees einwirken, bleibt in seiner exakten Kausalität noch unverstanden oder unbestimmt, aber der Wasserstand des Sees repräsentiert die Tendenz der Natur, ein Gleichgewicht zwischen Wasserzuführung und Wasserverdunstung herzustellen. Für Humboldt offenbart sich dieses Gleichgewicht besonders bei der Verteilung der Wärme auf dem Erdkörper, sichtbar in der Zone des ewigen Schnees in den verschiedenen Klimazonen, oder in seinem Konzept der isometrischen Linien.[9] „Das Gleichgewicht, welches mitten unter den Perturbationen scheinbar streitender Elemente herrscht, dies Gleichgewicht geht aus dem freien Spiel dynamischer Kräfte hervor, [...]“ heißt es in Humboldts erster Schrift, die er nach seiner Rückkehr aus Amerika veröffentlicht.[10] Die Aufgabe der Philosophie der Natur bestehe darin, alle Kräfte, die einen Einfluß ausüben, genau zu erfassen, auch wenn ihre wechselseitige Interaktion noch unklar bleibt. Ist dieses Gleichgewicht gestört, dann kommen nach Humboldt zwei Ursachen dafür in Frage, entweder hat die Natur aufgrund ihres erdgeschichtlichen Alters noch nicht ihr Gleichgewicht gefunden, oder es wird von außen interveniert. Noch unter dem Einfluß von Buffons Geologie prüft Humboldt die erste Vermutung, „da alle geognostische Phänomene in der noch nicht fertigen neuen Welt so neu sind, daß, sage ich, die Laguna de Valencia noch nicht die Balance zwischen zufließendem Wasser und Abdampfung getroffen, daß sie auch ohne von Menschen umwohnt zu sein, immer noch langsam abnehmen wird [...].“[11] Doch diese Erklärung wird nach der genauen Überprüfung der historischen Berichte zurückgewiesen, da sich ein enger Zusammenhang zwischen Kultivierung und Wasserverlust des Sees aufzeigen läßt: „[...] aber warum sie seit 60 Jahren so schnell abgenommen [...], das ist dem Menschenunfug zuzuschreiben, der die Naturordnung, den Wasserhaushalt stört.”[12] Am Ende seiner Tagebuchaufzeichnungen fragt Humboldt noch einmal, wird „die laguna ganz abnehmen? Gewiß nicht. Nur so lange als bis das Gleichgewicht zwischen Zufluß und Verdampfung hergestellt ist. Wie weit sie aber abnehmen wird, ist incalculabel, besonders wenn die Menschen fortfahren, die Öconomie der Natur so gewaltsam zu stören.“[13] In der Provinz Caracas fand Humboldt in den heißen Sommermonaten 1800 mit dem Valencia-See die idealen Bedingungen, um die Bedeutung des Waldes für den Wasserhaushalt des Bodens und des Klimas zu demonstrieren. Erst zwanzig Jahre später sollte er in einem schmalen Abschnitt seines Reiseberichtes, der sonst nur der wilden und gigantischen Natur, mit ihren ungeheuren und einsamen Weiten gewidmet ist, in der der Mensch mit seinem Werk gleichsam verschwindet, davon berichten.[14] In Amerika, in der Morgendämmerung einer Zivilisation (civilisation naissante) ließ sich der Faktor Mensch, der die Harmonie der unberührten Natur aus dem Gleichgewicht bringt, wie in einem gigantischen Laboratorium bestimmen. Humboldt ordnet seine Ergebnisse in einen globalen Zusammenhang ein, für ihn gibt es nach seiner Reise nur noch eine Natur. Die Andersartigkeit Amerikas, von der die französische Aufklärung ausgegangen war, kann als Erklärung nicht mehr herangezogen werden. „Länder in entgegengesetzten Hemisphären, die Lombardei am Fuße der Alpenkette und Nieder-Peru zwischen dem Stillen Meer und den Kordilleren der Anden, liefern einleuchtende Beweise für die Richtigkeit dieses Satzes.“[15] Der Satz, in dem Humboldt seine Ergebnisse bündelt, formuliert als ein Naturgesetz von universaler Bedeutung, sollte im 19. Jahrhundert bei der Verteidigung des Waldes eine enorme Wirkung entfalten: «En abattant les arbres qui couvrent la cime et le flanc des montagnes, les hommes, sous tous les climats, préparent aux générations futures deux calamités à la fois, un manque de combustible et une disette d´eau.» [16] [„Fällt man die Bäume, welche Gipfel und Abhänge der Gebirge bedecken, so schaffen die Menschen in allen Klimazonen kommenden Geschlechtern ein zwiefaches Ungemach: Mangel an Brennholz und Wassernot.“]
Der letzte Satz, der überraschenderweise den Mangel an Brennholz anführt, von dem bei den vorgenommenen Untersuchungen vorher nicht die Rede war, verweist deutlich auf Humboldts Stellung zwischen alter und neuer Naturauffassung. Er schleppt noch eine Begrifflichkeit aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert mit, die bei der Sorge um das fragile Gleichgewicht der Natur wie ein Fremdkörper wirkt. Die schon oben zitierte Formulierung im Tagebuch gibt uns einen klaren Hinweis, woher Humboldts Vorstellung der Holznot rührt: „Unbegreiflich, daß man im heißen, im Winter wasserarmen Amerika so wüthig als in Franken abholzt und Holz- und Wassermangel zugleich erregt.“[17] Von 1792 bis 1795 war Alexander von Humboldt in Franken, in den von Preußen erworbenen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth, als Oberbergmeister verantwortlich für die Bergwerke und das Hüttenwesen. Seine dreijährige Tätigkeit in Franken wird von einem Thema beherrscht, das in Deutschland und Frankreich Regierungen und Bevölkerung beschäftigt, nämlich die drohende Holznot. Wie ein roter Faden zieht sich durch Humboldts Briefe und Berichte die Frage, wie der für den Bergbau und für die Schmelzhütten so hohe Holzverbrauch reduziert werden kann.[18] Der Holzmangel soll durch technische Verbesserungen, durch Kohle als Brennstoff und durch Wiederaufforstung bekämpft werden. Während der Zeit des Markgrafen, also vor 1792, waren die Höhen des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes überwiegend ohne Waldbestand, da der jahrhundertealte Bergbau die vorhandenen Wälder verschlungen hatte. Darauf scheint sich Humboldts Bemerkung in Venezuela über das wütende Abholzen in Franken zu beziehen. In all den Briefen und Berichten Humboldts aus dieser Periode läßt sich an keiner Stelle so etwas wie ein modernes Umweltbewußtsein feststellen. Er bemüht sich ausschließlich um die Förderung einer in der Vergangenheit vernachlässigten Industrie in einer außerordentlich armen Gegend, die aufgrund der zunehmenden Verknappung von Nahrungsmitteln immer wieder von Hungersnöten heimgesucht wurde. Humboldt folgt dem preußischen Modernisierungsprogramm, das, wie Koselleck schreibt, für Adam Smith gegen Napoleon votierte.[19] Die „Holzbremse“ der vorindustriellen Gesellschaft, die die Betriebe durch den Hinweis auf ihren Holzverbrauch restringierte, sollte abgeschafft werden. Humboldt wollte auf die Holzknappheit nicht mit Produktionsbeschränkungen reagieren, sondern mit einem sorgfältigeren Umgang mit dem kostbaren Gut. Für ihn wurde die sich am Ende des 18. Jahrhunderts zuspitzende Subsistenzkrise zum Katalysator seiner Verwaltungstätigkeit und Wissenschaft.
In Amerika wandelt sich die Perspektive vollkommen. Ein emphatischer Naturbegriff tritt an die Stelle eines zweckrationalen Umgangs mit einer knapp werdenden Ressource. Natur wird zum Inbegriff einer harmonischen Ordnung, deren fragile Balance nur zu leicht durch den nur um seine kurzfristigen Vorteile besorgten Menschen gestört wird. Gewonnen wird mit diesem neuen Naturbegriff eine ganzheitliche Sichtweise, die weit auseinanderliegende Faktoren in die Analyse mit einbezieht und damit der heutigen Ökologie vorarbeitet. Descartes´ Discourse de la méthode ist nicht das Leitbild dieser Wissenschaft, die emotionale und ästhetische Elemente im Naturbezug nicht nur zuläßt, sondern fördert. Die Gefahr dieses neuen Naturbegriffs liegt allerdings darin, daß dieser Spekulationen weitgehend hilflos ausgesetzt ist, intuitive Annahmen ungeprüft übernimmt, und mit dem Bedürfnis, das reine Reich der Natur gegen die Eingriffe des Menschen zu verteidigen, apokalyptische Ängste nährt. Der Mensch wird aus dem Reich der Natur verbannt und zu ihrem Feind. „Man, the Disturber of Nature´s Harmonies“ sollte ursprünglich der Titel von George Perkins Marshs erfolgreichem Standardwerk (1864) heißen.[20] Aufgegeben wird damit auch die Vorstellung, daß der Mensch die Natur vervollkommnen könne, eine Position, die noch von Buffon, Reinhold und Georg Forster vertreten wurde.[21] Bei Buffon gehört es geradezu zur Aufgabe des Menschen, in der Natur ein harmonisches Gleichgewicht herzustellen, wo sie dazu selbst nicht in der Lage ist, wie z. B. in den von Menschen unberührten Wäldern. Waldzerstörung wird von nun an zum Inbegriff der Naturzerstörung, so wie der Wald zum Inbegriff der Natur wird. Eng damit verbunden ist eine im Vergleich zum 18. Jahrhundert kritischere Einstellung zur Kultivierung. Dem Kult der Landwirtschaft der Physiokratie folgt ein Kult des Waldes im 19. Jahrhundert. Das Zivilisationskonzept des 18. Jahrhunderts erfährt dadurch eine tiefe Umwertung.
Auch wenn Humboldt in seinem amerikanischen Reisewerk in erster Linie von einer grenzenlosen Begeisterung über die unendliche Kraft und Vielfalt der tropischen Natur getragen wird, und seine Untersuchung des Sees von Valencia eine Randstellung in seinem Gesamtwerk einnimmt, so verlor er die neugewonnene Fragestellung doch nicht mehr aus dem Auge. Sie taucht in seiner Untersuchung der Wassersysteme des Plateaus von Mexiko[22] und dann in den Klimastudien seines Berichtes über seine Asienreise noch einmal auf.[23] Die eigenen Erfahrungen in Venezuela, Mexiko und dann auf seiner Rußlandreise 1829 nach Sibirien, zum Altai, an den südlichen Ural bis an das kaspische Meer werden in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts mit Hilfe eines immer enger werdenden weltweiten Datennetzes in einen globalen Zusammenhang eingeordnet. Mit diesen späten Arbeiten gewinnen die Studien Alexander von Humboldts eine immer größere Autorität und Wirkung. Doch der entscheidende Durchbruch gelingt Humboldt durch seine Zusammenarbeit mit dem jungen französischen Wissenschaftler Jean-Baptiste Boussingault. Boussingault macht nicht nur die z. T. eher an versteckter Stelle veröffentlichten Studien Humboldts bekannt, er vermag ihnen auch eine überraschende, schwer zu wiederlegende Pointe zu geben. Von Holznot ist bei ihm keine Rede mehr.
1837 – fünf Jahre nach seiner Rückkehr aus Südamerika - erscheint Boussingaults großer Aufsatz über den Einfluß der Urbarmachung auf die Ergiebigkeit der Quellen in der von Arago und Gay-Lussac herausgegebenen Zeitschrift „Annales de Chimie et de Physique“[24]. Nur ein Jahr später folgt seine Übersetzung ins Englische.[25] So wurde der Aufsatz zur zentralen Argumentationshilfe in einer Umweltdiskussion, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts ihren ersten Höhepunkt erreicht. „Die Frage, ob der Ackerbau das Klima einer Gegend modificiren könne, ist sehr wichtig, und gegenwärtig häufig zur Sprache gebracht“ worden, heißt es bei Boussingault und er stellt die Frage, haben „die beträchtlichen Ausrodungen der Wälder, die Trockenlegung von Sümpfen, welche auf die Vertheilung der Wärme in den verschiedenen Jahreszeiten von Einfluß sind, auch Einfluß auf das Wasser, welches eine Gegend versorgt, entweder indem sie die Regenmenge vermindern, oder dem Regenwasser eine schnellere Verdunstung gestatten, wenn ausgedehnte Waldungen abgetrieben und in anbauungsfähiges Land verwandelt werden? An sehr vielen Orten glaubte man gefunden zu haben, daß die als bewegende Kraft benutzten Wasserbäche merklich schwächer geworden seien; auf anderen Puncten sah man sich zu der Annahme berechtigt, daß die Flüsse an Tiefe verloren, [...] man glaubt beobachtet zu haben, daß diese Abnahme des Wassers fast immer zu der Zeit eintrat, wo man anfing, die Waldung, welche die Oberfläche des Landes bedeckte, ohne alle Schonung und Umsicht niederzuschlagen.“[26] Zur Beantwortung der gestellten Frage zieht Boussingault die sorgfältige Untersuchung des Lago de Valencia in Venezuela durch Humboldt heran, erweitert jedoch seine Analyse durch eigene Beobachtungen an anderen Seen in Südamerika und ergänzt seine Ergebnisse noch durch die Messungen des Wasserstandes der Seen von Neuchâtel, Bienne und Morat durch Horace-Bénédict de Saussure[27] und durch Humboldts Beobachtungen im Aralo-Kaspischen Becken. Boussingault benutzte den Wasserspiegel von meist abflußlosen Seen als eine Art natürlichen „Regenmesser“, die „dazu vorhanden zu sein scheinen, um nach einem großen Maßstabe die Veränderungen zu schätzen, welche die Menge der Gewässer eines Landes erleidet.“[28] Seine Darstellung beginnt mit einer sensationellen Bestätigung der Beobachtungen Humboldts. Boussingault, der nach fünfundzwanzig Jahren ebenfalls den Lago de Valencia besucht, berichtet: „Seit mehreren Jahren hatten die Bewohner die Beobachtung gemacht, daß sich das Wasser des Sees nicht allein nicht mehr verminderte, sondern sogar ein merkliches Steigen wahrnehmen lasse. Ländereien, unlängst noch durch Baumwollenstauden bepflanzt, waren unter Wasser gesetzt. [...] Die von den Uferbewohnern so lange gehegten Befürchtungen hatten ihre Natur verändert; es war nicht mehr die völlige Austrocknung des Sees, was mit Sorgen erfüllte. Man fragte sich, ob diese Wasser noch lange fortfahren würden, sich des Eigenthums der Bewohner zu bemächtigen.“[29] Die Natur selbst scheint hier der Wissenschaft einen der seltenen Glücksfälle für die Bestätigung einer These zugespielt zu haben, die sich unter Laborbedingungen nicht verifizieren läßt. „Das friedliche Thal von Aragua war der Schauplatz der blutigsten Kämpfe gewesen. Ein Krieg auf Tod und Leben hatte die lachende Gegend zerstört, ihre Bevölkerung decimirt. Beim ersten Ruf nach Unabhängigkeit fand eine große Anzahl Sklaven ihre Freiheit, unter den Fahnen der neuen Republik Dienste nehmend. Die großen Anpflanzungen wurden verlassen, und der unter den Tropen so unaufhaltsam vordringende Wald hatte in kurzer Zeit einen großen Theil des Landes [...] wieder an sich gerissen.“[30] Es ist diese Falldarstellung, die im 19. Jahrhundert für die Verteidiger des Waldes Geschichte machen sollte. „Gewiss dem Anschein nach ein schlagender Beweis für den Waldeinfluss, wie man ihn glänzender nicht verlangen kann!“[31] kommentiert Eduard Brückner 50 Jahre später.[32] Die Bedeutung dieser Rückkehr der Wildnis für die Analyse der Funktion des Waldes im Wasserhaushalt der Natur scheint Boussingault allerdings erst nach der Rückkehr nach Frankreich aufgegangen zu sein, denn in seiner Autobiographie, die ausführlich über seinen Aufenthalt in Südamerika berichtet, findet sich keine Erwähnung der Beobachtungen, die das Zentrum seines Aufsatzes ausmachen.[33] Ja, es fehlt jede Andeutung auf eine Änderung des Wasserspiegels. Boussingault führt verschiedene Messungen durch, mißt die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit, beschreibt die Fische im See und lobt die Fruchtbarkeit der Bodenqualität des neugewonnenen Landes, ohne Humboldts kritische Einschätzung der intensiven Kultivierung auf Kosten des Waldes mit einem Wort zu erwähnen. Sieht man sich daraufhin noch einmal den Aufsatz an, so fällt auf, daß es in ihm keine exakten Meßdaten für die Steigerungsrate des Wasserniveaus gibt, keine Angaben über das Ausmaß der Rückkehr des Waldes und keine genaue Abwägung, ob die Zunahme des Wasserzuflusses nicht allein der Zerstörung der Bewässerungsanlagen und nicht dem Wald zuzuschreiben ist. Am Ende des Aufsatzes wird die wissenschaftliche Vorsicht von Boussingault ganz aufgegeben und der Mythisierung des Waldes als Regenspender Tor und Tür geöffnet.[34] Der Konflikt zwischen Zivilisation und Wald basiert bei Humboldt noch allein auf der erhöhten Verdunstungsrate des freigelegten Landes, auf dem Verlust der wasserspeichernden Funktion des Waldes, doch Boussingault geht einen entscheidenden Schritt weiter, wenn er trotz des Fehlens genauer Daten erklärt: „Für mich steht fest, daß das Ausroden der Wälder in großem Umfange die jährliche Regenmenge dieser Gegend verringert.“[35] In Thesenform heißt der letzte Satz des Aufsatzes: „Daß, indem man sich auf die in den Aequinoctialgegenden gesammelten meteorologischen Beobachtungen stützt, man annehmen muß, die Urbarmachungen vermindern die jährliche Regenmenge, die auf eine Gegend niederfällt.“[36] Im Vergleich zu den sorgfältigen Messungen, die Humboldt vornimmt, die von der Erfassung des Landschaftsprofils bis zur Überprüfung der überlieferten Zeugnisse reicht, bedeuten Boussingaults Untersuchungsverfahren einen deutlichen Rückschritt. Doch diese Mängel haben dem Erfolg seines Aufsatzes keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil. Als Erzählung gewinnt das Resultat Anschaulichkeit und Prägnanz und wird in dieser Form auch tradiert. So wird der Verlauf der Ereignisse immer wieder neu erzählt und bekommt eine mythische Qualität. Dabei verschwimmen immer mehr die genauen Details, die eine Überprüfung der Ergebnisse hätte möglich machen können.[37]
[1] Kenneth Thompson: Forests and Climate Change in America: Some early Views. In: Climate Change. An Interdisciplinary, International Journal Devoted to the Description, Causes of Climate Change. Ed. St. H. Schneider. Vol. 3, No. 1, 1980, S. 47-64.
[2] Alexander von Humboldt: Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Tagebüchern. Hrsg. von Margot Faak. Berlin 2000, S. 140.
[3] Ebd., S. 186.
[4] Ebd., S. 215.
[5] Ebd., S. 215.
[6] Ebd., S. 216.
[7] Klaus-Peter Seiler, Peter Trimborn und Jorge Alvarado: Das Grundwasser im Umfeld des Lago de Valencia, Venezuela und seine anthropogene und geogene, nachteilige Beeinflussung. In: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Bd. 143, S. 398-403.
[8] Alexander von Humboldt: Relation historique du Voyage aux Régions équinociales du Nouveau Continent. Tome Second. Paris 1819 [-1821], S. 72-74.
[9] Vgl. Humboldts bedeutenden Aufsatz “Von den isothermen Linien und der Verteilung der Wärme auf dem Erdkörper”. In: Alexander von Humboldt: Schriften zur physikalischen Geographie. Hrsg. von Hanno Beck. Darmstadt 1989, S. 18-97. Erstabdruck in : Mémoires de physique et de chimie de la Société d´Arcueil. Bd. III. Paris 1817, S. 462-602.
[10] Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. In: Ders.: Schriften zur Geographie der Pflanzen. Hrsg. von Hanno Beck. Darmstadt 1989, S. 70f.
[11] Alexander von Humboldt: Reise durch Venezuela., a. a. O., S. 215f.
[12] Ebd., S. 216.
[13] Ebd., S. 216.
[14] Alexander von Humboldt: Relation historique. Tome second, a.a.O. ,S. 65-83.
[15] Alexander von Humboldt: Relation historique. Tome second, a.a.O., S. 72.
[16] Ebd., S. 72. Zur Wirkungsgeschichte von Alexander von Humboldts Untersuchung des Sees von Valencia vgl. Clarence J. Glacken: Changing Ideas of the Habitable World. In: Man´s Role in Changing the Face of the Earth. New York 1956, S. 70-92, und Richard H. Grove: Green Imperialism. Colonial Expansion, Tropical Island Edens and Origins of Enviromentalism, 1600-1860. Cambridge 1995.
[17] Alexander von Humboldt: Reise durch Venezuela, a. a. O., S. 215.
[18] Alexander von Humboldt: Über den Zustand des Bergbaus und Hütten-Wesens in den Fürstentümern Bayreuth und Ansbach im Jahre 1792.
Wolfgang-Hagen Hein, Eberhard Arnold, Fritz Zürl: Alexander von Humboldts Generalbefahrungsberichte der fränkischen Gruben im Jahre 1795. Teil 1: Bericht über das Nailer Bergamts-Revier. In: Archiv für die Geschichte von Oberfranken, Bd. 72, S. 343-398, Bayreuth 1992. Teil II: Bericht über das Wunsiedler und das Goldkronacher Bergamts-Revier. In: Archiv für die Geschichte von Oberfranken, Bd. 73, S. 147-171. Bayreuth 1992.
[19] Reinhard Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848. Stuttgart 1987, S. 14.
[20] Georg P. Marsh: Man and Nature; or, Physical Geography as modified by human action. London 1864.
[21] Georg Forster: Ein Blick in das Ganze der Natur. Einleitung zu Anfangsgründen der Thiergeschichte. In: Ders.: Werke, Bd. 8: Kleine Schriften zu Philosophie und Zeitgeschichte. Bearb. von Siegfried Scheibe, Berlin 1974, S. 94ff. Johann Reinhold Forster: Remarks on the Changes of our Globe. In: Observationes Made during a Voyage round the World. Ed. by Nicholas Thomas, Harriet Guest, and Michael Dettelbach. Honolulu 1996, S. 99f.
[22] Alexander von Humbodt: Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Tome Prèmier, Paris 1809-1811, S. 208ff.
[23] Alexander von Humboldt: Recherches sur les causes des inflexions des lignes isothermes. In: Ders: Fragments de géologie et de la climatologie asiatiques. Tome second. Paris 1831, S. 397-564. Alexander von Humboldt: Asie centrale. Recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. 3 Vol. Paris 1843.
[24] J. B. Boussingault: Mémoire sur l´ Influence des Défrichemens dans la Diminution des Cours d´ Eau. In: Annales de Chimie et de Physique. Par MM. Gay-Lussac et Arago. Tome Soixante-Quatrième. Paris 1837. S. 113-141. Ich zitiere den Aufsatz nach der deutschen Übersetzung in J. B. Boussingault: Die Landwirtschaft in ihren Beziehungen zur Chemie, Physik und Meteorologie. Zweite Aufl. Zweiter Band Halle 1851.
[25] J. B. Boussingault: Memoir concerning the effect which the clearing of land has in diminishing the quantity of water in the streams of a district. In: Edinburgh New Philosophical Journal 24 (1838), S. 85-106. Unverändert übernimmt Boussingault den Aufsatz in seiner Buchpublikation: Économie rurale considerée dans ses rapports avec la chimie, la physique, et la météorologie. Paris 1843/44.
[26] J. B. Boussingault: Die Landwirtschaft in ihren Beziehungen zur Chemie, Physik und Meteorologie. Zweite Aufl. Zweiter Band Halle 1851, S. 413.
[27] Horace-Bénedict de Saussure: Voyage dans les Alpes, précédés d´un essai sur l´histoire naturelle des environs de Genève. 4 Bde, Neuchâtel-Geneva 1779-1796.
[28] J. B. Boussingault: Die Landwirtschaft, a.a.O. S. 415.
[29] Ebd., S. 418.
[30] Ebd., S. 418f.
[31] Eduard Brückner: Klimaschwankungen seit 1700 nebst Bemerkungen über die Klimaschwankungen der Diluvialzeit. Wien und Olmütz 1890, S. 17.
[32] Marsh zitiert ausführlich Boussingault und schreibt: “Boussingault - whose observations on the drying up of lakes and springs, from the destruction of the woods, in tropical America, have often been cited as a conclusive proof that the quantity of rain was thereby diminished [...] remarks: [...].” George P. Marsh: Man and Nature; or Physical Geography as Modified by Human Nature. London 1864, S. 191; 200-205.
[33] Mémoires de J.-B. Boussingault, Tome deuxième (1822-1823). Paris 1896, S. 53-63: “Vallés d´Aragua - Lac Tacarigua”
[34] Bereits Marsh äußert Vorbehalte gegenüber den Ergebnissen Boussingaults. Vgl. Marsh: Man and Nature, S. 191f. Vgl. auch die sorgfältige Untersuchung von Alberto Böckh, der ebenfalls Zweifel an den Ergebnissen Boussingaults äußert: Alberto Böckh: El Desecamiento del Lago de Valencia. Caracas 1956, 93-95, S. 129-134. Böckh bemerkt, daß Boussingault weder die erheblichen Schwankungen des Wasserstandes zwischen Winter- und Sommersaison, die in einigen Jahren bis zu zwei Meter betragen können, bedenkt, noch die Vernachlässigung der Bewässerung während des Bürgerkrieges, bei der häufig durch die Umleitung ganzer Flüsse große Mengen Wasser vergeudet wurde. Nach der Untersuchung von Böckh nimmt der Wasserstand des Lago de Valencia seit Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kontinuierlich ab. In 200 Jahren sinkt der Wasserstand um 17 Meter! Sicher scheint nach seiner Untersuchhung nur die Abnahme des Wasserstandes zu sein. Durch die Entwässerung von Sümpfen und die Wiedereinleitung von Flüssen in den See kommt es um 1900 zu einem Gleichgewicht von Zufluß und Wasserverlust.
[35] Boussingault: Die Landwirtschaft, a. a. O., S. 430.
[36] Ebd., S. 432.
[37] Zu den Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Angaben Humboldts und Boussingaults vgl. Alberto Böckh: El Desecamiento del Lago de Valencia. Caracas 1956.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>