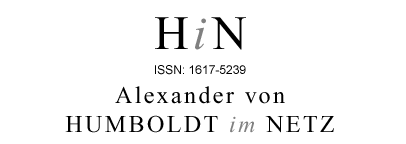
|
Archivkopie der Website http://www.humboldt-im-netz.de |
|---|
______________________________________________________
Engelhard Weigl
Wald und Klima: Ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert
1. Einleitung
Wald und Zivilisation stehen in Europa seit der Antike in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis. In der Differenz zu einem imaginierten Goldenen Zeitalter werden schon früh die Verletzungen, die der Erde in der Härte des Zivilisationsprozesses zugefügt wurden, angesprochen. „Noch war nicht,“ schreibt Ovid, „in den Bergen gefällt, die Fichte in die klaren Wogen hinabgestiegen, um eine fremde Welt zu besuchen. Keine Küsten kannten die Sterblichen – außer der, die sie selbst bewohnten. [...] Frei von Zwang, von keiner Hacke berüht, von keiner Pflugschar verwundet, gab von sich aus alles die Erde.“[1] Ein mehr oder weniger bestimmtes Gefühl der Illegitimität begleitet den Gewaltakt, mit dem der Mensch in den Prozeß der Natur eingreift, ein Gefühl, das sich bis zur Angst vor den unvorhersehbaren Folgen seines Handelns steigern kann. Im krassen Gegensatz zur historischen Bedeutung der Wald- und Rodungsarbeit findet sich kaum eine bildliche Darstellung seiner Arbeit von der Antike bis zur frühen Neuzeit.[2] Das heißt, es gab – so marginal es auch immer sei – ein Wissen von den Umweltschäden an neuralgischen Orten wie Bergwerken, Salinen und in Städten.[3] Metallgewinnung war im „hölzernen Zeitalter“ (Werner Sombart) zwangsläufig mit Waldzerstörung verbunden und die Sorge, daß Eisenhütten die Wälder überforderten, war spätestens im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa allgemein verbreitet. Noch in mythischer Rede klagt die Erde den bergbautreibenden Menschen in Paulus Niavis „Iudicium Iovis oder das Gericht der Götter über den Bergbau“ (1492-95) an. Die Najaden beschweren sich über Wasserentzug und Waldvertrocknung, die Faune über die Kohlenmeiler und Waldvernichtung. Die Abholzung ganzer Waldgebiete wurde so schon in der Renaissance mit Wassernot verbunden.[4] Die Verwissenschaftlichung des Umgangs mit dem Wald setzt mit John Evelyn, einem der Gründer der Royal Society of London ein, der den berühmtesten Aufforstungsaufruf der englischen Geschichte mit seinem „Sylvia or a Discourse on Forest Trees“ (1664) verfaßt hat. In Frankreich steht diesem Text die von Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) veranlaßte „Forstordnung“ von 1669 zur Seite. Das staatliche Interesse an der Sicherstellung der Industrie und des Flottenbaus überschattete allerdings die Sorge vor den illegitimen Eingriffen durch den Menschen.
Zu den früh wahrgenommenen unvorhergesehenen Folgen der Waldrodung gehört die Änderung des regionalen Klimas. Als erster widmete Theophrastos (372-288 v. Chr.), ein Schüler von Aristoteles, dem Thema des menschlichen Einflusses auf die Temperatur und die Qualität der Luft einer Region erste Überlegungen.[5] Mit ihm beginnt ein Diskurs, der durch die Entdeckung und Kolonisierung Amerikas einen enormen Aufschwung erfährt, im letzten Drittel des 19. Jahrhundert auf globaler Ebene seinen Höhepunkt erreicht, plötzlich um 1900 so gut wie verschwindet, um dann am Ende des 20. Jahrhunderts erneut mit voller Wucht wieder die breite Öffentlichkeit zu beschäftigen. In apokalyptischen Visionen malen Wissenschaftler heute den Moment des Zusammenbruches des Ökosystems der Erde aus, das beherrscht wird von dem waldvernichtenden Hunger eines fleischfressenden Primaten, der genetisch nur auf das Überleben seiner eigenen Familie programmiert ist, unfähig weiter als zwei Generationen zu denken. „[...] the forests shrink back to less than half their original cover. Atmospheric carbon dioxide rises to the highest level in 100,000 years. The ozone layer of the stratosphere thins and holes open at the poles.“[6] Der wachsende Bevölkerungsdruck läßt die Spannung zwischen Wald und Zivilisation ins Unerträgliche wachsen. „Whatever progress has been made in the developing countries, and that includes an overall improvement in the average standard of living, is threatened by a continuance of rapid population growth and the deterioration of forests and arable soil. “[7]
Die moderne Umweltdiskussion am Ende des 20. Jahrhunderts hat eine Art Mauer zur Vergangenheit errichtet, um den Bruch zwischen dem rücksichtslosen Umgang mit der Natur und dem späten Erwachen besser dramatisieren zu können. Die Suche nach den tief in der Geistes- und Glaubensgeschichte wurzelnden Gründen für die Destruktivität der Moderne hat die pragmatischen und mythischen Gegenkräfte, ausgeblendet. Humboldts Wissenschaftsmodell und seine enorme Wirkungsgeschichte im 19. Jahrhundert muß zu diesen bisher oft übersehenen Gegenkräften gezählt werden. Außer acht gelassen wird in dem von der modernen ökologischen Literatur verbreiteten Geschichtsbild zudem, daß zwischen „dem Streben nach Naturbeherrschung und der Erkenntnis ökologischer Zusammenhänge“ ein engerer Konnex besteht als man wahrhaben will.[8] An einem zentralen Grundproblem der Zivilisationsgeschichte, das sich aus dem Zurückdrängen der Wälder durch die Ausdehnung der Landwirtschaft ergab, wollen wir für das 19. Jahrhundert den Wandel der Argumentationsstruktur bei der Verteidigung der Wälder betrachten. Der Grundkonflikt zwischen dem Wald und der Landwirtschaft und dann auch der Industrie erfährt in Europa, in den USA und in den Kolonien im 19. Jahrhundert eine besondere Zuspitzung, die neue Ängste und eine tiefgreifende Veränderung der Argumentationsstruktur hervorruft. Mit der zunehmenden Verwissenschaftlichung dieses Diskurses verbindet sich ein überraschendes Paradox: Mit der Entwicklung eines ganzheitlichen Naturverständnisses, das sich immer genauerer empirischer Verfahren bedient, wächst dem Einfluß des Waldes eine geradezu mythische Größe zu. Bei der Beantwortung der Frage, wie es dazu hat kommen können, wird es nicht nur darauf ankommen, die wissenschaftlichen Verfahren zu überprüfen, die zu den wissenschaftlichen Annahmen über den Einfluß des Waldes geführt haben, sondern auch darauf, den tiefen Umformungsprozeß im Verhältnis des Menschen zur Natur im 18. und frühen 19. Jahrhundert mit einzubeziehen.[9] Der unter dem drohenden Bevölkerungsdruck immer weiter vorangetriebenen Perfektionierung der Ausbeutung der Natur steht eine wachsende Romantisierung der ursprünglichen Kraft des Waldes gegenüber. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung der weltweiten Veränderung der Landschaft und ihrer negativen Konsequenzen verdanken wir nach Glacken zwei einzigartigen Errungenschaften Europas: der Naturwissenschaft und der kritischen Geisteswissenschaft.[10] Aus der zeitlichen Distanz sind wir heute allerdings besser in der Lage, auch die irrationalen Momente bei der Verteidigung des Waldes und seine Funktionalisierung für bestimmte Machtinteressen zu erkennen. So wurde der Wald in Mitteleuropa am Ausgang des Mittelalters zur Grundlage der aufsteigenden Königsmacht in Frankreich und der entstehenden Territorialfürstentümer in Deutschland. „Nicht mehr durch Rodungen, sondern durch Waldschutz manifestierten Landesherren ihren Herrschaftsanspruch im Wald. [...] Seit dem 16. Jahrhundert stellten die Landesherren und ihre Juristen die Herrschaft über die großen Wälder wie selbstverständlich als ein uraltes Regal hin, obwohl es sich dabei in Wahrheit um eine neue Konstruktion auf brüchiger Traditionsbasis handelte.“[11] Die vor allem seit dem 16. Jahrhundert einsetzende Flut der Forstordungen diente nicht nur dem Ausbau des frühneuzeitlichen Territorialstaates, sondern hat auch dazu beigetragen, die Forstverwaltung und die Forstwissenschaft herauszubilden. Die Entdeckung des Waldschutzes als politisches Machtmittel hatte weitreichende Konsequenzen für den Umgang mit dem Wald in Mitteleuropa. Trotz allen Raubbaus entwickelt sich hier im Vergleich zu anderen Weltregionen ein praktisch wirksames Waldbewußtsein.[12] Als Leitfaden soll uns das einflußreiche Werk von Alexander von Humboldt dienen. Gemeinsam mit den Schriften Jean Baptiste Boussingaults entfalten die Forschungsergebnisse Humboldts im 19. Jahrhundert eine ungewöhnliche Wirkung, die zum ersten Mal in der Geschichte des Umweltbewußtseins globale Dimensionen erreicht. Alexander von Humboldts langes Leben eröffnet zudem die Möglichkeit, den Wandel des Naturverständnisses vom 18. zum 19. Jahrhundert genauer zu belegen. Als Student der Kameralwissenschaften und später als preußischer Oberbergmeister, der für die Bergwerke in den Fürstentümern Ansbach und Bayreuth Verantwortung trug, war Humboldt mit den herrschaftlichen Waldinteressen von Jugend an bestens vertraut.
[1] Ovid, Metamorphosen, Erstes Buch, Vers 95-103.
[2] Michael Diers: Warburg aus Briefen. Kommentare zu den Kopierbüchern der Jahre 1905-1918. Weinheim 1991 (Schriften des Warburg-Archivs im Kunsthistorischen Seminar der Universität Hamburg; Bd. 2) S. 172.
[3] Nürnberg erlebte bereits im Spätmittelalter einen dramatischen Energieengpass, der zur Stillegung und Vertreibung der holzverschlingenden Gewerbe führte. Diese existenzbedrohende Entwicklung wurde jedoch 1368 durch die Erfindung der Waldsaat durch den Nürnberger Montanunternehmer, Rats- und Handelsherrn Peter Stomeir abgefangen, dem es zum ersten Mal in der Forstwirtschaft gelang, planmässig und im grossen Ausmass Wald anzusäen. Das neue Verfahren der Nadelwald-Saat breitete sich schnell in den gewerblichen Ballungsräumen um Nürnberg und Frankfurt und den Montanrevieren aus. Vgl. Wolfgang von Stromer: Der Ursprung der Forstkultur: Die Erfindung der Nadelwaldsaat Nürnberg 1368. Naturbeobachtung, Versuche, Praxis und Erfolge. In: L'Uomo e la Foresta, secc. XIII-XVIII. a cura di Simonetta Cavaciocchi. Istituto Francesco Datini, Atti II/27, Firenze 1996, S. 499-519.
[4] Vgl. Hartmut Böhme: Geheime Macht im Schoß der Erde. Das Symbolfeld des Bergbaus zwischen Sozialgeschichte und Psychohistorie. In: Natur und Subjekt. Frankfurt a. M. 1988, S. 67-144.
[5] Clarence J. Glacken: Traces on the Rhodian Shore. Nature and Culture in Western Thought from Acient Times to the End of the Eighteenth Century. Berkeley, Los Angeles, London 1973, S. 130.
[6] Edward O. Wilson: Is Humanity Suicidal? (1993) In: In Search of Nature. London 1996, S. 181-199, hier S. 183.
[7] Ebd., S. 193.
[8] Joachim Radkau: Warum wurde die Gefährdung der Natur durch den Menschen nicht rechtzeitig erkannt? Naturkult und Angst vor Holznot um 1800. In: Hermann Lübbe/Elisabeth Ströker (Hrsg.): Ökologische Probleme im kulturellen Wandel. Paderborn 1986, S. 72.
[9] Rainer Beck: Ebersberg oder das Ende der Wildnis. Eine Landschaftsgeschichte. München 2003.
[10] Clarence J. Glacken: Changing Ideas of the Habitable World. In: William L. Thomas jr. (Hrsg.): Man´s Role in Changing the Face of the Earth. New York 1956, S. 92.
[11] Joachim Radkau: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. München 2000, S. 167.
[12] Ebd., S. 170.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>