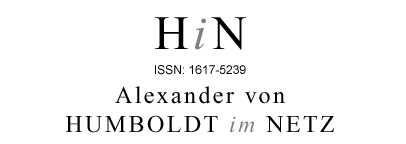
______________________________________________________
Joseph Gomsu
Humboldts Umgang mit lokalem Wissen
2. Kuhbaum-Episode
Im März 1800 sind Humboldt und Bonpland unterwegs von Puerto Cabello nach Valencia an der Küste von Venezuela. Seit mehreren Wochen, so erzählt Humboldt, hören sie von einem Baum sprechen, dessen Saft eine nährende Milch sei. Dies halten sie zunächst für eine etwas sonderbare Behauptung, die sich jedoch als wahr erweist. Die Indianer und die afrikanischen Sklaven nennen diesen Baum den Kuhbaum oder auch den Milchbaum. Wenn man in dem Stamm des Baumes einen Einschnitt macht, so Humboldt, dann „fließt reichlich eine klebrige, ziemlich dickflüssige Milch heraus, die durchaus nichts Scharfes hat und sehr angenehm nach Balsam riecht“.[1] Humboldt teilt dem Leser seine persönlichen Beobachtungen vor Ort mit: „Beim Sonnenaufgang strömt die vegetabilische Quelle am reichlichsten; dann kommen von allen Seiten die Schwarzen und die Eingeborenen mit großen Näpfen herbei und fangen die Milch auf, die sofort an der Oberfläche gelb und dick wird. Die einen trinken die Näpfe unter dem Baum selbst aus, andere bringen sie ihren Kindern.“ (Reise I, 678)
Was Humboldt in diesem wie in ähnlichen Fällen tut, ist, eine eigene Erfahrung zu machen, um auf sicherer Grundlage darüber berichten zu können. Aus diesem Grund kostet er die Milch und findet sie zwar klebrig, aber sonst von angenehmem Geschmack und aromatischem Geruch. Er nimmt davon eine Probe, die er dem französischen Chemiker Fourcroy zur näheren Untersuchung nach Paris schickt. Dann geht er der Frage nach, was man bisher über diesen Baum wisse, und gelangt zu der Auffassung, dass bis jetzt kein Botaniker dieses Gewächs kenne. Erst lange nach der Rückkehr nach Europa liest er in einer Publikation des Holländers Laet über Westindien, es gebe in der Provinz Cumaná Bäume, „deren Saft geronnener Milch“ gleiche und „ein gesundes Nahrungsmittel“ abgebe. (Reise I, 679) Das bedeutet, dass Indianer oder schwarze Sklaven diejenigen sind, die die Eigenschaften dieses Baums entdeckt haben. Europäische Wissenschaftler verdanken hier den Vertretern des Lokalen ihr Wissen nicht nur über den Kuhbaum, sondern überhaupt darüber, dass Pflanzen Milch enthalten können. Europäische Botaniker und Chemiker können jetzt von dieser Entdeckung der Einheimischen ausgehen, um ihre Arbeit weiterzuführen.
Was das Wissen über Pflanzen und ihre besonderen physischen Eigenschaften angeht, so konstatiert Humboldt: „Lange bevor die Chemie im Blütenstaub, im Überzug der Blätter und im weißen Staub unserer Pflaumen und Trauben kleine Wachsteilchen entdeckte, verfertigten die Bewohner der Anden von Quindío Kerzen aus der dicken Wachsschicht, welche den Stamm einer Palme überzieht. Vor wenigen Jahren wurde in Europa das Caseum, der Grundstoff des Käses, in der Mandelmilch entdeckt; aber seit Jahrhunderten hält man in den Gebirgen an der Küste von Venezuela die Milch eines Baumes und den Käse, der sich in dieser vegetabilischen Milch absondert, für ein gesundes Nahrungsmittel.“ (Reise I, 680f., Hervorhebung teils im Original, teils von mir J.G.)
Humboldt beschränkt sich hier nicht auf den Fall des Kuhbaums. Dieser wird vielmehr zum Auslöser eines erweiterten Gedankenkreises, indem Humboldt sich damit auseinandersetzt, was man überhaupt über die besonderen Eigenschaften von Pflanzen weiß. So stellt er neben den Kuhbaum als weiteres Beispiel eine Palmenart, aus der die Peruaner Wachskerzen herstellen. Die Kenntnisse der Einheimischen, seien es nun Peruaner oder Venezuelaner, über die besonderen physischen Eigenschaften der Palmenart und des Kuhbaums vergleicht Humboldt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen der Europäer und konstatiert, dass ein lokales Wissen in den von ihm bereisten Gegenden Südamerikas einen zeitlichen Vorsprung habe. Eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Herstellung von Wachskerzen hat einen deutlichen Rückstand, was ebenfalls bezüglich der pflanzlichen Milch gilt: Erst vor wenigen Jahren habe man in Europa den Grundstoff des Käses in der Mandelmilch entdeckt, während man in Venezuela die Baummilch und den Baumkäse seit Jahrhunderten kennt. Diese Konfrontation von lokalem Wissen und modernem europäischen Wissen und die daraus resultierende Ungleichzeitigkeit stellen Humboldt vor ein Rätsel.
„Woher rührt dieser seltsame Gang in der Entwicklung unserer Kenntnisse? Wie konnte das Volk auf der einen Halbkugel etwas erkennen, was auf der anderen dem Scharfblick der Chemiker, die doch gewöhnt sind, die Natur zu befragen und sie auf ihrem geheimnisvollen Gang zu belauschen, so lange entgangen ist? Daher, daß einige wenige Elemente und Prinzipien verschiedenartig kombiniert in mehreren Pflanzenfamilien vorkommen; daher, daß die Gattungen und Arten dieser natürlichen Familien nicht über die äquatoriale und die kalten und gemäßigten Zonen gleich verteilt sind; daher, daß Völker, die fast ganz von Pflanzenstoffen leben, vom Bedürfnis getrieben mehlige nährende Stoffe überall finden, wo sie nur die Natur im Pflanzensaft, in Rinden, Wurzeln oder Früchten niedergelegt hat.“ (Reise I, 681, Hervorhebung von mir, J.G.)
Humboldt hält diese Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung der Kenntnisse für „seltsam“ und fragt sich, wie es komme, dass so etwas wie die Baummilch so lange dem gewohnten Scharfblick des Chemikers habe entgehen können. Der Chemiker, der doch darauf spezialisiert ist, die Natur zu ‚befragen’, sie zu ‚belauschen’ und in deren inneren Zusammenhang einzudringen, befindet sich trotz seiner Qualifikation und seines Scharfblicks im Rückstand. Humboldt versucht, eine Erklärung für den Vorsprung des lokalen Wissens zu finden.
Seine drei Erklärungsversuche lassen sich durch einen Begriff zusammenfassen, den man als Geographismus bezeichnen kann. Lokalverhältnissen wird eine entscheidende Rolle bei der geistigen wie physischen Entwicklung des Menschen zugeschrieben. Es handelt sich hier um eine bis heute von vielen geteilte Meinung: Ngugi wa Thiong’o schreibt in diesem Zusammenhang in seinem eingangs angeführten Essay Die Universalität regionalen Wissens: „Kultur entwickelt sich in einem Prozess, in dem ein Volk sich mit seinem natürlichen und sozialen Umfeld kämpferisch auseinandersetzt.“[2] In seinem Essay Über lokale und allgemeine Bildung misst auch Forster Lokalverhältnissen eine entscheidende Rolle bei: „Was der Mensch werden konnte, das ist er überall nach Maasgabe der Lokalverhältnisse geworden.“[3] Ohne mit dem Geographismus alles erklären zu wollen, ist festzuhalten, dass Lokalverhältnisse einen bedeutenden Einfluss auf die physische und geistige Beschaffenheit der Menschen haben können. Da jedes Volk ein ihm eigentümliches natürliches Umfeld hat, verfügt es demnach auch über ein ihm spezifisches Wissen, das jedoch verallgemeinerbar sein kann.
Die ungleiche Verteilung der Naturpflanzen führt in der Tat dazu, dass der Kuhbaum nur in einem bestimmten Gebiet der Tropenzone wächst, während der Mandelbaum nur in der gemäßigten anzutreffen ist, was zu einer Ungleichzeitigkeit in der Entdeckung ihrer jeweiligen Eigenschaften führen kann. Denn je nach dem, ob man in einer Situation der Not oder des Bedürfnisses ist oder nicht, wird man sich bemühen, nach besonderen Substanzen der Pflanzen zu suchen. Nach dem Motto ‚Not macht erfinderisch’ erklärt sich Humboldt und relativiert aber zugleich einen Wissensvorsprung des Lokalen und, umgekehrt, seinen möglichen Rückstand. Denn Lokalverhältnisse, die den einheimischen Indianern und Schwarzen im konkreten Fall ihren Vorsprung ermöglichen, können auch dazu führen, dass sie sich weniger anstrengen, um ihr Wissen zu erweitern. Die „Segensfülle der Natur“, so Humboldt in derselben Episode, begünstige in den Tropenregionen „die träge Sorglosigkeit der Menschen“ und verhindere die Entwicklung seiner Geistesfähigkeiten. (682) Und noch deutlicher formuliert: „Bei einer üppigen Vegetation mit so unendlich mannigfaltigen Produkten bedarf es dringender Beweggründe, soll der Mensch sich der Arbeit ergeben, sich aus seinem Halbschlummer aufrütteln, seine Geistesfähigkeiten entwickeln.“[4]
Humboldt lässt den Leser wissen, wie stark die Entdeckung der physischen Eigenschaften des Kuhbaums ihn beeindruckt habe; im Verlauf seiner Reise hätten nur wenige Erscheinungen einen stärkeren Eindruck auf seine Einbildungskraft gemacht als diese durch Anschauung gewonnene Einsicht in die Natur. Das Wissen der Einheimischen führt Humboldt über die physikalische Erkenntnis der Gegenstände hinaus zu „einem anderen Kreise von Vorstellungen und Empfindungen“, nämlich zu Überlegungen naturphilosophischer Art. In der Einleitung zum Kosmos vertritt er die These, „dunkle Gefühle und die Verkettung sinnlicher Anschauungen, wie später die Tätigkeit der kombinierenden Vernunft“ leiteten zu der Erkenntnis, „daß ein gemeinsames, gesetzliches und darum ewiges Band die ganze lebendige Natur umschlinge“.[5] Die Entdeckung der physischen Eigenschaften des Kuhbaums durch die Bewohner der Küste Venezuelas bildet die empirische Grundlage dieser philosophischen Position. Bisher habe man geglaubt, nährende Milch sei ein ausschließliches Produkt des tierischen Organismus, und nun müsse man feststellen, dass physische Eigenschaften der tierischen und der vegetabilischen Stoffe im engsten Zusammenhang stünden. „Nichts steht für sich allein da; chemische Prinzipien, die, wie man glaubte, nur den Tieren zukommen, finden sich in den Gewächsen gleichfalls. Ein gemeinsames Band umschlingt die ganze organische Natur.“ (Reise I, 680, Hervorhebung von mir, J.G.) Das „gemeinsame Band“, das Humboldt später in Kosmos zum Gesetz erhebt, verdankt er einem lokalen Wissen der Schwarzen und der Indianer in Venezuela.
Humboldt ergänzt seine naturphilosophische Überlegung durch eine ästhetische und rundet damit die Kuhbaum-Episode ab. Jedes tiefere Eindringen in das innere Wesen der Naturkräfte und die Ergründung allgemeiner Gesetze könnten dazu führen, dass die Natur ihren Zauber, ihren Reiz einbüße. Eine Möglichkeit, die Humboldt als Gefahr betrachtet. In der Kuhbaum-Episode seines Reiseberichts hegt er noch diese Befürchtung: „Die naturwissenschaftliche Untersuchung zeigt, daß die physischen Eigenschaften der tierischen und der pflanzlichen Stoffe im engsten Zusammenhang stehen; aber sie benimmt dem Gegenstand, der uns in Erstaunen setzte, den Anstrich des Wunderbaren, sie entkleidet ihn wohl auch zum Teil seines Reizes.“ (Reise I, 680) Mit einem „aber“ zeigt Humboldt an, dass er bedaure, wenn die wissenschaftliche Arbeit dem Gegenstand den Anstrich des Wunderbaren nehme und ihn seines Reizes entkleide.
Später, im Kosmos, wird Humboldt diese Meinung entschieden revidieren: „Ich kann daher der Besorgnis nicht Raum geben,[...] daß bei jedem Forschen in das innere Wesen der Kräfte die Natur von ihrem Zauber, vom Reiz des Geheimnisvollen und Erhabenen verliere.“ (Kosmos I, 28) Wenn also bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Gegenstand sein „Wunderbares“ und seinen „Reiz“ nicht verliert, dann heißt das, dass ein lokales Wissen durch seine Verwissenschaftlichung auch nicht spurlos verschwinde. In Humboldts „physischer Weltbeschreibung“, in seiner „Lehre vom Kosmos“, vermag deshalb wissenschaftliches Wissen sich mit einem Naturgenuss zu verbinden und diesen sogar noch zu vermehren und zu ‚veredeln’. Ein in diesem Sinne ‚aufgeklärter’ Naturgenuss bleibt aber für Humboldt im Lokalen, im Besonderen verortet, deshalb ist es wichtig für ihn, eine Wissenschaft zu betreiben, die - aller Universalität zum Trotz - gerade die Lokalität mit ihrem Wunderbaren, ihrem Reiz und ihrem Zauber respektiert und integriert.
Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong’o schließt seinen schon zitierten Essay über die Universalität regionalen Wissens mit einem Gedanken, der ganz im Sinne dieser Humboldtschen Dialektik von Lokalität und Globalität ist: „Regionales Wissen ist keine einsame Insel für sich, es ist ein Teil der See, Teil des Meeres. Seine Grenzen liegen in der grenzenlosen Universalität unseres kreativen Potentials als Menschen.“[6]
[1] Alexander von Humboldt: Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents, Bd.1, hg. von Ottmar Ette, Frankfurt am Main 1991, S.677.
[2] Ngugi wa Thiong’o: Die Universalität regionalen Wissens, a.a.O., S.48.
[3] Forster: Über lokale und allgemeine Bildung, a.a.O., S.45. Hervorhebung von mir, J.G.
[4] Humboldt: Reise in die Äquinoktial-Gegenden, a.a.O., S. 685, Hervorhebung von mir, J.G. Sicherlich kann eine solche Erklärung denen Vorschub leisten, die die Bewohner außereuropäischer Regionen immer schon für „faul“ und überhaupt für Menschen zweiter Klasse gehalten haben.
[5] Alexander von Humboldt: Kosmos, hg. von Hanno Beck, Studienausgabe Bd. Darmstadt 1993, S. 17. Hervorhebung von mir, J.G.
[6] Ngugi wa Thiong’o: Die Universalität regionalen Wissens, a.a.O., S.50.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>