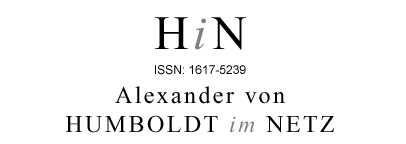
______________________________________________________
Eberhard Knobloch
Berlin-Brandenburgische Akademie der WissenschaftenErkundung und Erforschung
Alexander von Humboldts AmerikareiseFrau Dr. Margot Faak zu ihrem 80. Geburtstag gewidmet.
4. Die Ergebnisse
Noch während der Reise hielt Humboldt brieflich Kollegen in der alten und der neuen Welt über seine wissenschaftliche Ausbeute auf dem Laufenden. Kaum in der neuen Welt, im venezolanischen Cumaná angelangt, schrieb er an Zach am 17. November 1799, sie hätten in dieser Provinz über 1600 Pflanzen getrocknet, gegen 600 größtenteils neue, unbekannte und kryptogamische beschrieben und die schönsten Muscheln und Insekten gesammelt, die Länge und Breite von mehr als 15 Ortschaften bestimmt, die einst zu Fixpunkten einer Karte vom Innern des Landes würden dienen können (Moheit 1993, 53f.; Moheit 1999, 39).
Ihm lag daran, dass seine Erkenntnisse der Mit- und Nachwelt erhalten bleiben. Er bat Zach deshalb, seine Beobachtungen dem Pariser Bureau des Longitudes mitzuteilen, da seine Briefe an dieses Bureau verloren gegangen seien.
Aus dem peruanischen Ayabaca berichtet Humboldt Tovar y Ponte in Venezuela am 2. August 1802, unermesslich seien die Früchte gewesen, die sie bei ihrer Reise durch das Königreich Neugranada, sprich Kolumbien, die Provinzen Popayán und Los Pastos hätten sammeln können. Die Botanik, die Astronomie und die astronomische Geographie seien gleichermaßen bereichert worden. Den Sextantenenthusiasten Humboldt hatte insbesondere beeindruckt, in Popayán einen Quadranten und in Francisco José de Caldas jemanden angetroffen zu haben, der die Jupitermonde beobachtete, für Humboldt eine der Methoden, um Längengrade zu bestimmen (Moheit 1993, 189; Moheit 1999, 134).
Aus Mexiko-Stadt schließlich schreibt er am 29. Juli 1803 an Delambre, Bonplands und sein Herbarium sei eines der größten, das je nach Europa gelangt sei. Ihre Manuskripte enthielten mehr als 6000 Beschreibungen von Spezies, er habe zahlreiche Zeichnungen von Palmen, Gräsern und anderen seltenen Gattungen angefertigt, sie brächten mehrere Arbeiten über vergleichende Anatomie, viele Kästen mit Insekten und Muscheln mit, dank ihrem Eifer und ihrer Energie (Moheit 1993, 245; Moheit 1999, 181). Seinem venezolanischen Tagebuch hatte er die Bemerkung anvertraut: „Mit Besinnung und Energie übersteht man alles“ (Humboldt 2000, 181). Tatsächlich war der Nichtschwimmer Humboldt wiederholt in unmittelbarer Lebensgefahr gewesen. Dazu gehörte seine unverhoffte Begegnung mit einem Tiger (damit meint Humboldt den Jaguar) in Venezuela (Humboldt 2000, 249), das Umschlagen des Bootes auf dem Orinoco mit Bonplands Rettungsruf «Ne craignez pas mon ami, nous nous sauvons» (Humboldt 2000, 258), der Überfall eines Zambos in der Nähe Cumanás (Humboldt 1814-1825 I, 508f.; Ette 1991, 444f.), der Orkan am 9. Mai 1804 auf der Überfahrt nach Philadelphia (Humboldt 2003a, 398). Fast wäre eingetreten, was Humboldt scherzhaft Delambre schrieb: Delambre solle nicht über seine, Humboldts Unbeständigkeit lachen. Er glaube, dass er entweder an einer Krateröffnung oder von den Wellen des Meeres verschlungen werden sollte (Moheit 1993, 246; Moheit 1999, 182).
Tatsächlich gingen Humboldt und Bonpland keiner Gefahr aus dem Wege. Obwohl jedermann ihnen gesagt hatte, sie würden bei dem Versuch, den Vulkan Cotapaxi zu besteigen, sterben, hätten sie es für ihre Pflicht gehalten, das Schrecknis aus der Nähe zu betrachten (Humboldt 2003a, 290; Humboldt 2003b, 182):
«Il parut de notre devoir d’examiner le monstre de près».
Es war die Pflicht der Wissenschaft gegenüber. Humboldts heitere Gelassenheit verließ ihn – wenn überhaupt – nur kurzfristig. An Zach schrieb er aus Cumaná (Beck 1985, 141 Anm. 84), sie seien dort von Tigern und Krokodilen umgeben, die sich gar nicht genierten und einen weißen oder schwarzen Mann für einen gleich guten Bissen hielten. Mit anderen Worten: Krokodile kennten keinen Rassismus. Für den Fall seines Todes versuchte er vorzusorgen. Aus Havanna schrieb er am 21. Februar 1801 an Willdenow, wer von seinen Freunden und Bekannten in dem Fall die verschiedenen Manuskripte edieren sollte: Delambre die astronomischen, Blumenbach die zoologischen, Willdenow die botanischen usf. (Moheit 1993, 124; Beck 1985, 197). Ohne es zu sagen, machte so Humboldt klar, dass er keinen Gelehrten sah, der es ihm hätte gleichtun und sämtliche Manuskripte hätte bearbeiten können.
Die Fülle der Aufgaben war freilich überwältigend. Allein um die Ameisenarten und ihre Ökonomie zu beschreiben, wäre ein ganzes Menschenleben in Süd-Amerika nicht hinlänglich, vertraute er seinem Tagebuch an (Humboldt 2000, 305).
Auf allen Seereisen waren ihm Flauten immer erwünscht, um die Beobachtungen mit der Inklinationsbussole vervollkommnen zu können (Humboldt 2003a, 295; Humboldt 2003b, 188). Ohnehin nutzte er jede denkbare Gelegenheit, um sein Messprogramm durchzuführen. Als die Schiffsbesatzung in Cumaná auf die Erlaubnis des Gouverneurs wartete, an Land gehen zu dürfen, nutzte Humboldt die Zeit, um die geographische Länge des Hafendammes von Santa Cruz zu bestimmen und die Inklination der Magnetnadel zu beobachten (Humboldt 1814-1825 I, 102; Ette 1991, 106). In Quito lernte er Rosa Montúfar kennen, die Schwester seines Reisebegleiters Montúfar. Diese wusste von Humboldt zu berichten (Beck 1985, 236): „Bei Tisch verweilte er ... nie länger, als notwendig war, den Damen Artigkeiten zu sagen und seinen Appetit zu stillen. Dann war er immer wieder draußen, schaute jeden Stein an und sammelte Kräuter. Bei Nacht, wenn wir längst schliefen, guckte er sich die Sterne an.“ Auf der Reise von Quito nach Lima zeichnete er Pflanzen, wenn das Frühstück noch nicht zur Verfügung stand (Humboldt 2003a, 243; Humboldt 2003b, 132). Um so enttäuschter war er, als in Lima wegen des spanischen Phlegma, wie er sagte, kein Marineoffizier den Merkurdurchgang beobachten wollte, er also der Einzige und wahrscheinlich der Erste gewesen ist, der dies dort tat (Humboldt 2003a, 284; Humboldt 2003b, 175f).
Seine Tagebücher sind voller Klagen über die unbegreiflichen Qualen, die sie täglich vom Stechen des Ungeziefers erlitten. Unmöglich sei es daher gewesen, ein ordentliches und ausführliches Tagebuch zu führen (Humboldt 2000, 259). Man habe geglaubt, alle Sekunden alle Instrumente, Blumenteile verzweiflungsvoll fallen zu lassen, wenn alle Hände voll stechender Insekten gewesen seien und man keine dritte Hand gehabt hätte, sich ihrer zu erwehren (Humboldt 2000, 261). Nicht alle Beobachtungen seien deshalb wegen der Moskitos machbar gewesen, wie es dem Interesse an den umgebenden Objekten entsprach (Humboldt 1814-1825 I, 271; Ette 1991, 862f.). „Warum lasst Ihr Euch aufzehren von Moskitos, nur um ein Land zu vermessen, das Euch nicht gehört?“ musste sich Humboldt fragen lassen, eine Frage, die Enzensberger in seinem „Mausoleum“ aufgegriffen hat (Enzensberger 1994, 62).
So groß die Plage war, sie garantierte Normalität, während ihr unerwartetes, wenn auch nur vorübergehendes Verschwinden nicht glückliche Erleichterung, sondern zunehmende Besorgnis auslöste, die Ordnung der Natur habe sich verkehrt. In Esmeralda am oberen Orinoco soll 1795 zwanzig Minuten lang die Luft ganz frei gewesen sein, wie man Humboldt erzählte. Man fürchtete das Schlimmste, ein großes Erdbeben. Als sich die Luft wieder mit Moskitos füllte, freute man sich ordentlich, dass sie wieder da waren.
Lakonisch kommentierte Humboldt die Erzählung: Wir glaubten den Menschen zu sehen, misstrauisch, ungewiss darüber, was ihm drohe, seine alten Leiden bedauernd (Humboldt 1814-1825 I,581f.; Ette 1991, 1228).
Dennoch: Ganz überwiegend Bonpland hat in all den Jahren den «Journal botanique», ein siebenteiliges Feldbuch, verfaßt (Lack 2004). Humboldt hat allen Schwierigkeiten zum Trotz schließlich zweihundert astronomische Ortsbestimmungen und an fünfhundert Höhenmessungen erfolgreich durchgeführt, wie er im Vorwort zum Astronomischen Teil seines Reisewerks nicht ohne Genugtuung bemerkte (Humboldt/Oltmanns 1810b I, S. IX; Leitner 2005, 34). Er hatte sich bemüht, zur Absicherung seiner Ergebnisse nicht nur den Chronometer, sondern alle Methoden der Längenbestimmung zugleich anzuwenden, also die Abstände des Mondes von der Sonne und den Fixsternen, die Jupitermonde, Sonnen- und Mondfinsternisse hinzuzuziehen. Ausdrücklich vermerkte er, dass die Wahl der Instrumente nicht allein durch den Zweck bestimmt wird, den man erreichen soll, sondern auch durch die Lage, in welcher man zu beobachten hat (Humboldt/Oltmanns 1810b I, S. XXII).
Humboldt hatte es sich zur Pflicht gemacht, alle angestellten Beobachtungen in sein Tagebuch einzutragen. Er zeichnete die kleinsten Umstände auf, die die Genauigkeit der Winkel bestimmen konnten, eine Vorsichtsmaßnahme, die auch im Falle seines Todes die Beurteilung seiner Ergebnisse ermöglichen sollte und von Oltmanns anerkennend bestätigt wurde (Humboldt/Oltmanns 1810b I, S. VIII; II, 275). Programmatisch hielt er sich an Ciceros Ausspruch (De divinatione II, 11; Humboldt/Oltmanns 1810b II, S. V; die in eckigen Klammern gesetzten Worte hat Oltmanns fortgelassen):
“Hoc ego philosophi non arbitror, testibus uti qui [aut] casu veri aut [malitia] falsi [fictique] esse possunt. Argumentis et rationibus oportet, quare quidquid ita sit, docere : non eventis.”
„Das, so glaube ich, ist nicht Aufgabe des Philosophen, Zeugen zu verwenden, die entweder zufällig wahr oder aus Bosheit falsch und erfunden sein können. Man muß mit Argumenten und Gründen, nicht durch Ergebnisse, darlegen, warum was auch immer gerade so ist.“
______________________________________________________
 |
© hin-online.de.
postmaster@hin-online.de |
 |