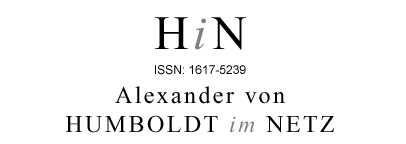
______________________________________________________
Joseph Gomsu
Humboldts Umgang mit lokalem Wissen
4. Über die Kunststraßen der Inkas
Vor der spanischen Konquista existierten in Südamerika auf der Grundlage lokalen Wissens hoch entwickelte Kulturen. Im weiteren Verlauf der Reise wird Humboldt mit den Ruinen der zerstörten Hochkulturen der Inka und der Azteken konfrontiert. Dies gibt ihm Gelegenheit, über das Wissen der alten Peruaner und dessen technische Umsetzung sowie über die Verantwortlichen für die Zerstörung nachzudenken. In dem Essay Das Hochland von Cajamarca aus den Ansichten der Natur kommt Humboldt auf die Kunststraßen der Inkas und auf ihr Bewässerungssystem zu sprechen. „Der ernste Eindruck, welchen die Wildnisse der Kordilleren hervorbringen, wird auf eine merkwürdige und unerwartete Weise dadurch vermehrt, daß gerade noch in ihnen bewunderungswürdige Reste von der Kunststraße der Inkas, von dem Riesenwerk sich erhalten haben, durch welches auf einer Länge von mehr als 250 geographischen Meilen alle Provinzen des Reiches in Verbindung gesetzt waren.“[1] Was Humboldt bewunderungswürdig findet, ist zweifelsohne das Genie dieses Volks, d.h. das Wissen, worüber die Inkas verfügt haben müssen, um ein solches „Riesenwerk“ zustande zu bringen. Beeindruckend nicht nur für Humboldt, sondern auch für den heutigen Leser ist die Länge dieser das ganze Inka-Reich umspannenden Straße: 250 geographische Meilen sind umgerechnet 1855 km.
„Noch herrlichere Trümmer der altperuanischen Kunststraßen haben wir auf dem Weg zwischen Loja und dem Amazonenstrom bei den Bädern der Inkas auf dem Paramo de Chulucanas [...] gesehen. [...] Von den zwei Systemen gepflasterter, mit platten Steinen belegter, bisweilen sogar mit zementierten Kieseln überzogener (makadamisierter) Kunststraßen gingen die einen durch die weite und dürre Ebene zwischen Meeresufer und der Andenkette, die anderen auf dem Rücken der Kordilleren selbst. Meilensteine gaben oft die Entfernung in gleichen Abständen an. Brücken dreierlei Art, steinerne, hölzerne oder Seilbrücken führten über Bäche und Abgründe; Wasserleitungen zu den Tambos (Hotellerien) und festen Burgen. [...] Da die Peruaner sich keines Fuhrwerks bedienten, die Kunststraßen nur für Truppenmarsch, Lastträger und Scharen leicht bepackter Lamas bestimmt waren, so findet man sie bei der großen Steilheit des Gebirges hier und da durch lange Reihen von Stufen unterbrochen, auf denen Ruheplätze angebracht sind.“ (Das Hochland, 329, Hervorhebungen von mir, J.G.)
Die Ruinen der Inka-Straßen zeugen von einer großen Vielfalt im Umgang mit dem Baumaterial: mal waren die Straßen bepflastert, mal mit platten Steinen belegt und manchmal sogar asphaltiert. Dazu waren sie mit Meilensteinen versehen. Genauso wie beim Straßenbau war ihre Technik beim Brückenbau vielfältig: hölzerne, steinerne oder Seilbrücken führten über Bäche und Abgründe. Wasserleitungen waren nicht nur für Hotels oder Burgen bestimmt, es gab ein ganzes Bewässerungssystem in den heißen Küstenebenen, das für die Felder bestimmt war. Es handelt sich im vorkolumbianischen Amerika um eine Infrastruktur, die ihresgleichen sucht.
Eine beschleunigte Entwicklung des Inka-Reichs wurde vor allem durch das Militär induziert. So muss die technische Anwendung des Wissens im engsten Zusammenhang mit der militärischen Eroberung gesehen werden. Im altperuanischen Staat war diese technische Entwicklung bereits ähnlich „veloziferisch“, wie Goethe eine durch die Erfordernisse schnellstmöglicher Truppentransporte während der napoleonischen Kriege induzierte Entwicklung in Europa genannt hat. Die Inka-Dynastie benötigte diese ‚Schnellstraßen’, um ihre Herrschaft über das Reich zu erweitern und zu konsolidieren. Trotz seiner Bewunderung für die technischen Leistungen der Inkas unterstreicht Humboldt die mit dieser militärischen Dimension bei der technischen Anwendung des Wissens einhergehende Unterdrückung der Untertanen: „Unter dem despotischen Zentralisations-System der Inka-Herrschaft waren Sicherheit und Schnelligkeit der Kommunikation, besonders der Truppenbewegung ein wichtiges Regierungsbedürfnis.“ (330, Hervorhebung von mir, J.G.)
Der Vergleich gehört zu den wichtigsten Arbeitsmethoden Humboldts. In seinem Selbstverständnis als Reisender und Naturforscher ist der Vergleich insofern wichtig, als er ermöglicht, „in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen“. So ist es nicht verwunderlich, dass er die ‚Schnellstraßen’ der Inkas mit ähnlichen Leistungen in Europa vergleicht. „Was ich von den römischen Kunststraßen in Italien, dem südlichen Frankreich und Spanien gesehen, war nicht imposanter als diese Werke der alten Peruaner.“ (328f.) Humboldt zitiert den Konquistador Hernando Pizarro, einen der Zerstörer dieser Errungenschaften, der einen ähnlichen Vergleich angestellt habe und zu dem Schluss gekommen sei: „In der ganzen Christenheit sind so herrliche Wege nirgends zu sehen als die, welche wir hier bewundern.“ (330, Hervorhebung von mir, J.G.) Der Zerstörer ist merkwürdigerweise auch ein Bewunderer der eroberten Kultur: Warum zerstört er dann das Bewunderte? Humboldt zitiert diese Aussage des Konquistadoren, um seinen eigenen Eindruck zu bestätigen, aber er tut das vielleicht auch, um die Widersprüchlichkeiten der Europäer zu zeigen, die nach der Zerstörung oder Vernichtung sich beeilen, Reservate einzurichten und Museen zu bauen.
Humboldts Vergleich wie der des spanischen Konquistadoren enthalten implizit die Frage, wie die Inkas solche technische Leistungen haben vollbringen können. Es ist die Frage, wie das dazu erforderliche Wissen überhaupt entstehen konnte. In seinem Essay führt Humboldt einen Chronisten der Konquista an und zitiert seine explizite Frage: „Sarmiento, der die Inka-Straßen noch in ihrer ganzen Erhaltung sah, fragt sich in einer Relacion, [...] ‚wie ein Volk ohne Gebrauch des Eisens in hohen Felsgegenden so prachtvolle Werke [...] von Cuzco nach Quito und von Cuzco nach der Küste von Chile habe vollenden können?’ ‚Kaiser Karl’, setzt er hinzu, ‚würde mit aller seiner Macht nicht einen Teil dessen schaffen, was das wohl eingerichtete Regiment der Inkas über die gehorchenden Volksstämme vermöchte.’“ (330) Humboldt antwortet hier - wie in der Kuhbaum-Episode -, indem er auf den Einfluss der geographischen Lokalverhältnisse und der lokalen Bedürfnisse hinweist: „Wo durch Gestaltung des Bodens die Natur dem Menschen großartige Hindernisse zu überwinden darbietet, wächst mit dem Mut auch die Kraft.“ (330)[2] Und zwar die Geisteskraft (d.h. das Wissen), muss man hinzufügen.
Die Ruinen der Kunststraßen wie andere Reste technischer Leistungen der alten Peruaner gehen nicht aus einem inneren Zusammenbruch hervor, sie sind das Resultat der Konquista. Nachdem die Konquistadoren diese Straßen für ihre eigenen Eroberungszwecke - schnelle Bewegung der Truppen - genutzt haben, haben sie sie zerstört, was Humboldt ganz entschieden verurteilt. Im Essay Das Hochland von Cajamarca kommt diese Kritik kaum zur Sprache. Dagegen findet sich in den Tagebuchaufzeichnungen eine in schärfstem Ton formulierte Kritik an der Zerstörungswut der spanischen Konquistadoren: „Die spanischen Eroberer unterhielten nicht nur die Kanäle [Bewässerungskanäle, J.G.] nicht, sondern zerstörten sie ebenso wie die Kunststraßen des Inka. [...] Sie benehmen sich außerhalb ihrer eigenen Länder barbarisch wie Türken - schlimmer, weil sie noch fanatischer sind.“[3] Humboldt scheut sich nicht, den Spaniern den Vorwurf des Barbarentums zu machen. Besonders schlimm findet er die Tatsache, dass eine autonome, nicht aus der Verpflanzung europäischer Wissenschaft und Technologie hervorgegangene, sondern sich auf ein lokales Wissen gründende Kultur in ihrer Entwicklung so brutal gestoppt wurde. In seinem Tagebuch notiert er hierzu: „Außerordentlich bemerkenswert in Cascas ist ein ungeheuer großer, viereckig behauener Stein von mehr als einhundertsechzig Kubikfuß, der auf drei andere zylindrisch zugerichtete Steine aufgesetzt ist. Vorn hat er ein Loch. Das Ganze macht deutlich, wie die alten Peruaner ihre Bausteine bewegten. [...] Die Barbaren Westeuropas haben den Vorgang der Arbeit unterbrochen.“[4] Der letzte Satz des Zitats bezieht sich zwar auf die Arbeit an einer einzigen Baustelle der Inkas, macht aber auch deutlich, dass damit ein ganzer Entwicklungsprozess gemeint ist. Der gesamte Entwicklungsprozess der Inka-Kultur, einer auf eigenen Füßen stehenden und die eigenen geistigen Ressourcen mobilisierenden Kultur, wurde durch die Konquista abgebrochen. Humboldts Kritik an der Zerstörungswut der spanischen Konquistadoren lässt vermuten, dass er sich neben einer Entwicklung europäischer Prägung eine andere, auf lokalem Wissen basierende vorstellen konnte. Es handelt sich um eine Vorstellung von Moderne, die möglicherweise verschiedene Zentren gehabt hätte.
Die drei herangezogenen Episoden aus dem Reisewerk haben gezeigt, dass Alexander von Humboldt das Wissen außereuropäischer Regionen an lokale natürliche und kulturelle Bedingungen gebunden sieht, es in seinem eigenen Sinne darstellt und gleichzeitig darum bemüht ist, dieses Wissen so zu universalisieren, dass es, um mit der Metapher von Ngugi wa Thiong’o zu sprechen, ‚keine einsame Insel’ sei, sondern ‚Teil des Meeres’ bleiben könne. In diesem Sinne stimme ich mit Leo Kreutzers Vorschlag überein, neben anderen Komposita wie Weltgesellschaft, Welthandel, Weltwirtschaft oder Weltliteratur auch von einer „Weltwissenschaft“ zu sprechen. Dort würde ein lokales Wissen nicht mehr als statisch und ‚traditional’ im Gegensatz zu ‚moderner’ Wissenschaft abgetan, vielmehr als dynamisch in einer dialektischen Beziehung zu dieser stehend gesehen und behandelt.[5]
[1] Humboldt: Das Hochland von Cajamarca, in: Ansichten der Natur, hg. von Hanno Beck, Studienausgabe Bd.4, Darmstadt 1989, S.328. Hervorhebung von mir, J.G.
[2] Humboldt ist mit diesem Chronisten in einem Punkt gewiß nicht einverstanden: Was Sarmiento ein „wohl eingerichtetes Regiment“ nennt, ist für ihn, wie bereits zitiert, ein „despotisches Zentralisations-System“.
[3] Humboldt: Die Wiederentdeckung der Neuen Welt, a. a. O., S. 337.
[4] Ebd., S.336. Hervorhebung von mir, J.G.
[5] Vgl. Leo Kreutzer: Die Lokalität von Wissen und ihre Universalisierung bei Georg Forster und Alexander von Humboldt, in: Weltengarten. Deutsch-Afrikanisches Jahrbuch für Interkulturelles Denken, Hannover 2003, S. 112-125.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | I. Jahn >>