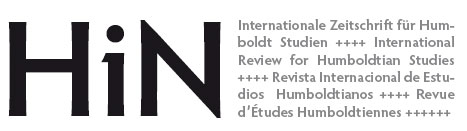
 |
____________________________________________________
|
 |
|||
|
Petra Werner Innenwelten und bleiche Gärten. Alexander von Humboldt untertage und in der Caripe-Höhle
|
|||||
|
1. Einleitende Bemerkungen[1] Die verborgene Welt im Innern der Erde nahm im wissenschaftlichen Denken Alexander von Humboldts einen festen Platz ein – verbrachte der Bergmann doch einige Zeit seines Lebens untertage[2] und besuchte an verschiedenen Orten der Welt auch Höhlen. Was die Untertage-Welt des Bergbaus betrifft, so muss diese unterirdische Landkarte, die Humboldts Bewegungen nachvollzieht, noch gezeichnet werden, zahlreiche Hinweise auf die Stollen, in denen er sich aufhielt, werden in seinen Jugendbriefen und in seinem frühen Werk Flora Fribergensis erwähnt. Wie aus dieser Monographie und aus seinen Briefen hervorgeht, prägten sich untertage bei Humboldt jene Interessen aus, die den Wissenschaftler sowohl experimentell als auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die er z. T. zusammen mit bedeutenden Chemikern wie Gay-Lussac verfasste, beschäftigten. Auch in seinem Alterswerk Kosmos kam er darauf zurück und machte in mehreren Bänden, unter anderem in Band IV, der den geologischen Wissenschaften gewidmet war, dazu Ausführungen. Aber es waren nicht nur physiologisch-chemische, botanische, geologische und zoologische Gebiete, die Humboldt im Zusammenhang mit Höhlen beschäftigten, sondern auch Überlappungen zwischen Naturwissenschaften und Kunst, die ihn später zum Kontakt mit bildenden Künstlern führten. Humboldt hatte sich nach eigener Aussage häufig in der Höhle von Muggendorf im Harz aufgehalten, auch die sogenannten „unterirdischen Wunder von Derbyshire“ besucht, die Grotten von Ojców und Stremieszyce in Galizien, von Vincenza sowie die Höhle von Castleton (The Devil’s Arse).[3] Es bleibt zu vermuten, dass Humboldt vor allem aus naturwissenschaftlichem Interesse dort weilte, dennoch ist wahrscheinlich, dass die Gattung der Höhlengleichnisse, begründet von Platon, die die Höhle als Symbol für Einheit und Identität der Gegensätze[4] charakterisiert, dem Kenner antiker Literatur gut bekannt war. Humboldt, der glaubte, nunmehr alle Höhlen zu kennen, war besonders überrascht von der Guácharos-Höhle in der Nähe von Caripe: Die Natur gehorcht unter allen Zonen unabänderlichen Gesetzen in der Verteilung der Gesteine, in der äußeren Gestaltung der Berge, selbst in den gewaltigen Veränderungen, welche die äußere Rinde unseres Planeten erlitten hat. Bei dieser großen Gleichförmigkeit konnte ich glauben, die Höhle von Caripe werde im Aussehen von dem, was ich auf meinen früheren Reisen beobachtet, nicht sehr abweichen; aber die Wirklichkeit übertraf meine Erwartungen bei weitem.[5] Humboldt beschrieb in der Reise in die Äquinoktialgegenden des Neuen Kontinents genauer, worin für ihn die Überraschung bestand – sie betraf weniger die sogenannte „unorganische Natur“, sondern den „großartige[n] tropische[n] Pflanzenwuchs an der Mündung des „Erdlochs“, der einen ganz eigenen Charakter habe.[6] Wie seine eindrückliche, emotionale Beschreibung verrät, faszinierte Humboldt die Höhle weit über die wissenschaftliche Wahrnehmung hinaus. Diese Höhle wurde ein wichtiges Motiv für Künstler, vor allem den Kunstmaler Ferdinand Bellermann, später den Ornithologen und Künstler Anton Goering. 2. Naturwissenschaftliche Fragestellungen aus Chemie, Geologie, Physiologie, Botanik und Zoologie Die naturwissenschaftlichen Fragen, die Alexander von Humboldt untertage beschäftigten, standen am Anfang. Dazu gehörten: a) Die Zusammensetzung der Luft: Die Luft untertage bedeutete wegen der Ansammlung verschiedener Gase für den Bergmann eine latente Gefahr. Humboldt publizierte nicht nur theoretische Erkenntnisse in Form eines Briefes Ueber Grubenwetter und die Verbreitung des Kohlenstoffs in geognostischer Hinsicht (aus einem Briefe an Hrn. Prof. Lampadius von Hrn. F. A. v. Humboldt), sondern machte 1796 auch eine praktische Erfindung, um das Übel zu bekämpfen. Er publizierte: Ueber die einfache Vorrichtung, durch welche sich Menschen stundenlang in irrespirablen Gasarten, ohne Nachtheil der Gesundheit, und mit brennenden Lichtern aufhalten können; oder vorläufige Anzeige einer Rettungsfläche und eines Lichterhalters[7] und widmete sich in seiner Monographie Über die unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren Nachtheil zu verhindern. Ein Beitrag zur Physik und practischen Bergbaukunde auch explizit der Atmosphäre untertage. 1799 schließlich fasste er wissenschaftliche Erkenntnisse in der Monographie Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über einige andere Gegenstände der Naturlehre zusammen.[8] Besonders faszinierten Humboldt jedoch optisch wahrnehmbare Seltsamkeiten untertage, hier entwickelte er einige Interessen weiter, die er schon in Berlin vor seinem Studium in Freiberg hatte und die ihn Zeit seines Lebens in Anspruch nehmen sollten. Dazu gehört die Speläo- bzw. Höhlenbotanik. Zu den Themen, die ihn interessierten, gehören b) die Farbstoffbildung bei Pflanzen und der damit zusammenhängende Prozess der Photosynthese. Dem Thema widmete Humboldt zwischen 1792 und 1794 sieben Schriften[9] einschließlich eines noch unveröffentlichten Manuskriptes. c) Außerdem interessierte sich der Gelehrte, der in seinen pflanzengeographischen Untersuchungen auch niederen Organismen wie Algen besondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte, auch für jene Kleinstlebewesen, die sein Freund und Reisegefährte Christian Gottfried Ehrenberg, der heute als einer der Begründer der Mikrobiologie gilt, erforschte. 1829, bei seiner Russlandreise, fuhr Humboldt als über Sechzigjähriger in Stollen ein, kratzte mit Ehrenberg schleimige Beläge von den Balken. Hierbei zeigte Humboldt, wie sich sein Reisegefährte in Russland, Christian Gottfried Ehrenberg erinnerte, große Unerschrockenheit.[10] Flechten bzw. Algen faszinierten Humboldt auch deshalb, weil er eine Beziehung zwischen dem Gestein des Standorts und dem Vorkommen von Organismen auf Basalt erkannte. In diesem Sinne schrieb er schon 1789 an Paul Usteri: Bei einer kleinen Reise, die ich längst dem Rhein machte, bemerkte ich, dass Lich[en] crispus eine dem Basalte sehr eigene Flechtenart ist. Auch fand ich zwischen Linz und Unkel zuerst Lich[en] capperatus auf Thon-Schiefer. Jeder Stein kann gewiss nicht jeder Pflanze zum Wohnort dienen. Die Natur folgt hier noch unerkannten Gesezen, die nur erforscht werden können, dass Botaniker mehr Data zur Induktion liefern.[11] Dieses Thema interessierte ihn auch auf anderen seiner Reisen, u. a. durch England, wo er an Kalkwänden verschiedene Algen, Moose und Flechten wiederfand, die er schon aus der Gegend um Göttingen kannte. In diesem Zusammenhang beschäftigte ihn nicht nur das Vorkommen an bestimmten Standorten bzw. die Ausbreitung, sondern auch die wirtschaftliche Nutzung als Färbemittel.[12] Die Färberflechte (= Lackmus), seit dem 11. Jahrhundert zu einer violetten Saftfarbe verarbeitet, wurde unter der Bezeichnung „Tournesol“[13] eingeführt und Humboldt vertrat die Ansicht, dass dieser teure Importfarbstoff durch Produkte aus einheimischen Flechten ersetzt werden könnte. d) Geologische und meteorologische Aspekte. Die Vielschichtigkeit, die sich für Alexander von Humboldt mit dem Begriff „Höhle“ verband, wird in der Vielfalt seiner Untersuchungen deutlich, dies zeigt sich in den Unterbegriffen, die sich im Register seines Alterswerkes Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung finden. Humboldt nahm Höhlen sowohl als geologische Gebilde bzw. Ausdruck geologischer Aktivität wahr (dies belegen Begriffe wie Berg, Gebirge, Meer, Obsidian, Vulkane, Wasser, Dampf, Erde), als auch als archäologische und wissenschaftsgeschichtliche Fundstätten (u. a. von Tierknochen usw.). Darüber hinaus beschäftigten ihn, wie aus seinem Nachlass hervorgeht, auch die klimatischen Verhältnisse untertage und in Höhlen wie der Caripe-Höhle. Humboldt führte im ersten, 1845 erschienenen Band des Kosmos aus: Die Zweifel über die Erdwärme zwischen den Wendekreisen, zu denen ich selbst vielleicht durch meine Betrachtungen in der Höhle von Caripe (Cueva del Guácharo) Anlaß gegeben habe (Rel. hist. T. III, p. 191–196) werden durch die Betrachtung gelöst, daß ich die vermuthete mittlere Luft-Temperatur in der Höhle (18º, 5) nicht mit der Luft-Temperatur in der Höhle (18º, 7), sondern mit der Temperatur des unterirdischen Baches (16º, 8) verglichen hatte; ob ich gleich selbst schon ausgesprochen (Rel. hist. T. III. p. 146 und 194), daß zu den Wassern der Höhle sich wohl höhere Bergwasser könnten gemischt haben.[14] Humboldt machte zahlreiche Aufzeichnungen über Grubentemperaturen[15] und fertigte 1820 einen Entwurf zu einer Publikation an,[16] die nie veröffentlicht wurde. Was die paläontologische Dimension betrifft, so hatte Humboldt in mehreren Veröffentlichungen, u. a. in seinen 1806 erschienenen Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, auf das „Innere der Erde“ verwiesen und gemeint: Dringen wir gar in das Innere der Erde, durchwühlen wir die Grabstätte der Pflanzen und Thiere, so verkündigen uns die Versteinerungen nicht bloß eine Vertheilung der Formen, die mit den jetzigen Klimaten in Widerspruch steht; nein, sie zeigen uns auch kolossale Gestalten, welche mit den kleinlichen, die uns gegenwärtig umgeben, nicht minder contrastieren, als die einfache Heldennatur der Griechen gegen die Charaktergröße neuerer Zeit.[17] Sowohl in seinem Alterswerk Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung als auch in Relation historique bzw. Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents[18] war Humboldt auf Funde fossiler Tierknochen in Höhlen zu sprechen gekommen: Ich hatte die schöne Höhle von Treshemienshiz in den Karpaten befahren, ferner die Höhlen im Harz und in Franken, die große Grabstätten sind für die Gebeine von Tigern, Hyänen und Bären, die so groß waren wie unsere Pferde.[19] e) Schon im Berliner Tiergarten,[20] aber auch in seiner Freiberger Zeit und in Oberfranken untertage sowie in den Höhlen Südamerikas, schenkte Humboldt unterirdisch vorkommenden Pflanzen große Aufmerksamkeit. Er malte sie auch – einige der Zeichnungen wurden in seiner Flora Fribergensis publiziert. In sein 1806 geschaffenes Tableau „Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern; ein Naturgemälde der Anden, gegründet auf Beobachtungen und Messungen, welche vom 10ten Grade nördlicher bis zum 10ten Grade südlicher Breite angestellt worden sind, in den Jahren 1799 bis 1803. Von Alexander von Humboldt und A. G. Bonpland“ fügte er auch das sogenannte „Königreich“ der unterirdischen Pflanzen ein und zählte jene Vertreter einzeln auf, die er gezeichnet und z. T. als „elegante Spezien“ bezeichnet hatte: Lichen verticillatus, Byssus claviata, Byssus speciosa, Boletus stratus. Im Text seines Werkes Geographie der Pflanzen, dem das Tableau beigelegt war, kam Humboldt auf seine Flora Fribergensis von 1793 zu sprechen und betonte, er habe bereits dort ausgeführt, dass die Pflanzengeographie […] die Gewächse nicht bloß nach Verschiedenheit der Klimate und Berghöhen [ordnet, P. W.], in welchen sie sich finden; sie betrachtet dieselben nicht bloß nach den wechselnden Graden des Luftdruckes, der Temperatur, der Feuchtigkeit und elektrischen Tension, unter welchen sie sich entwickeln: sie unterscheidet unter den zahllosen Gewächsen des Erdkörpers, wie unter den Thieren, zwey Klassen, die in ihrem Verhältnisse gegen einander (und so zu sagen in ihrer Lebensweise) weit von einander abstehen.[21] Er meinte damit Algen (Algae) und Pilze (Fungi). War Humboldt vor seiner Exkursion nach Caripe und die Guácharas-Höhle noch der Meinung (s. o.), er habe durch den Besuch mehrerer Höhlen das Wichtigste erfasst und durch den Eindruck von „Einförmigkeit“ die Lust verloren, weitere Höhlen zu besuchen, so war er doch beeindruckt von der Höhle von Caripe. Ihn faszinierten neben der Flora der Umgebung, die er ausführlich beschrieb und aufzählte – vermutlich in Erinnerung an seinen früheren Untersuchungen – die unterirdischen bleichen, wie Humboldt es ausdrückte, „etiolierten“ Gärten: Man watet im Schlamm. Fällt diese Dammerde durch Regen in das Innere der Felsen, oder ist es Niederschlag aus den am Tage eindringenden Wassern? In dieser Erde sieht man ganze Beete 2 F[uß] hoher, keimender Pflanzen, ein unterirdischer, etiolierter Garten. Da die Vögel unzählige Samen und Früchte in die Höhle schleppen, so keimen diese dort. Die etiolirten Stengel waren sehr hoch und sonderbar gestaltet nach Verschiedenheit der Pflanzenart.[22] f) Auch in zoologischer Hinsicht war Humboldt von der Höhle beeindruckt, besonders fremdartige Geräusche von in der Höhle lebenden Vögeln fielen ihm auf. Er zeichnete die Tiere und widmete ihnen allgemeine Schilderungen bzw. anatomische Untersuchungen.[23] In seinem Tagebuch beschrieb er ausführlich den Besuch der Höhle: Wo das Tageslicht zu verschwinden anfängt, hört man ein fernes, dumpfes Gekrächze der zahllosen Vögel Guácharo´s, welche diese Höhle so berühmt gemacht haben. Der Guácharo gehört zum Geschlecht Caprimulgus. Ich habe ihn gezeichnet[24] und unten weitläufig systematisch beschrieben. Der Vogel würde einem ungelehrten Menschen ein bärtiger Habicht heißen. Er ist schön bunt gefleckt, braun mit schwarzen Punkten und weißen herzförmigen Augen. Der Unterschnabel, der mit einer dünnen Haut bespannt ist, und das ungeheuer krötenartige Maul lassen schon die krächzende Stimme ahnden, deren das Thier fähig ist. Wer viele 1000 Krähen in hohen Fichten hat zusammen nisten sehen, kann kaum einen Begriff von dem wüthigen Lermen haben, welchen die Guácharos in der Höhle betreiben. Sie nisten alle in 50–60 F[uß] Höhe, wo das Gewölbe mit trichterförmigen Löchern ausgehöhlt ist. Dieser Umstand macht den Ton noch dumpfer, da der Widerhall ihm mehr Umfang giebt. Je tiefer man in die Höhle dringt, desto stärker wird der Lermen. Bisweilen hört das Gekrächze in einem Gewölbe auf, und man hört nur das entferntere Chor. […] Den Chiamas ist die Höhle der Eingang zur Hölle. Die nächtlichen Vögel sind Vögel der Hölle. So bei den Griechen der acheron und die Stygischen Vögel. Zu den Guácharos gehen heißt auf Chaimisch sterben. Die abgeschiedenen Seelen sind im hintersten Theile der Höhle. Daher wagt kein Inder, allein in die Höhle zu gehen, und wir bemerkten sichtbaren Widerwillen und Angst bei denen, welche wir zwangen, mit uns vorzudringen. Sie versicherten, die Fackeln würden verlöschen, ohnerachtet der Vorrath groß war.[25] Humboldt schilderte, wie Bonpland in seinem Beisein zwei Guácharos unter großen Schwierigkeiten erlegen konnte, nachdem er 12 vergebliche Schüsse abgegeben hatte. Es ist unsicher, ob Humboldt einen dieser Vögel – den in der linken oberen Ecke sitzenden Vogel zeigt das von Humboldt in seiner Authentizität bestätigte Aquarell von Eduard Hildebrandt[26] – später in der Bibliothek seiner Berliner Wohnung in der Oranienburger Straße als Präparat aufbewahrte. Johannes Müller verdanken wir die Aussage, dass „die Sammlungen des Herrn v. Humboldt, welche den Quacharo enthielten, […] durch Schiffbruch im Jahre 1801 an der Küste von Africa zu Grunde gegangen [sind, P. W.].“[27] Diese Vögel, die damals für endemisch gehalten wurden, konnten inzwischen in mindestens 68 Höhlen in Venezuela nachgewiesen werden.[28] In seiner Arbeit Das nächtliche Thierleben im Urwalde, die er u. a. dem 2. Band der dritten und vermehrten und verbesserten Ausgabe von Ansichten der Natur beigab, hatte sich Humboldt eindrücklich mit den im Urwald vorkommenden Geräuschen befasst. Gelegentlich betonte er, dass die Frage nach dem Zustandekommen von Tiergeräuschen ihn angeregt habe, anatomische Untersuchungen anzustellen. Nicht nur in der französischen, sondern auch in der deutschen Ausgabe von Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie, gesammelt auf einer Reise nach den Tropenländern des neuen Kontinents 1799–1804, hatte Humboldt ausführliche anatomische Vergleiche zwischen Vögeln, Affen und dem Krokodil angestellt. Bei den Vögeln hatte er neben verschiedenen Papageien und Fasanen auch den Guácharo untersucht.[29] In dieser Publikation hatte er auch jene Zeichnungen veröffentlicht, die er später als Originale Ferdinand Bellermann überreichte (s. u.). Auf seine zoologischen Untersuchungen kam Humboldt mehrfach zurück, u. a. in seinem Text Reise in die Äquinoktialgegenden: Der Guacharo hat die Größe unserer Hühner, die Kehle der Ziegenmelker und Procnias, die Gestalt der geierartigen Vögel mit Büscheln steifer Seide um den krummen Schnabel. Streicht man nach Cuvier die Ordnung der Picae (Spechte), so ist dieser merkwürdige Vogel unter die Sperlingsvögel einzuordnen, deren Gattungen fast unmerklich ineinander übergehen. Ich habe ihn im zweiten Bande meiner Observations de Zoologie et d’Anatomie comparée in einer eigenen Abhandlung unter dem Namen Steatornis (Fettvogel) beschrieben. Er bildet eine neue Gattung, die sich vom Caprimulgus durch den Umfang der Stimme, durch den ausnehmend starken, mit einem doppelten Zahn versehenen Schnabel, durch den Mangel der Haut zwischen den vorderen Zehengliedern wesentlich unterscheidet. Er liefert das erste Beispiel eines Nachtvogels unter den Zahnschnäblern der Sperlingsvögel (Passereaux dentirostres). In der Lebensweise kommt er sowohl den Ziegenmelkern als auch den Alpenkrähen nahe. Sein Gefieder ist dunkel graublau, mit kleinen schwarzen Streifen und Tupfen; Kopf Flügel und Schwanz zeigen große, weiße herzförmige schwarz gesäumte Flecken. Die Augen des Vogels können das Tageslicht nicht ertragen, sie sind blau und kleiner als bei den Ziegenmelkern. Die Flügel haben 17–18 Schwungfedern, und ihre Spannweite beträgt 3½ Fuß. Der Guácharo verlässt die Höhle bei Einbruch der Nacht, besonders bei Mondschein. Er ist so ziemlich der einzige körnerfressende Nachtvogel, den wir bis jetzt kennen; schon der Bau seiner Füße zeigt, dass er nicht jagt wie unsere Eulen. Er frisst sehr harte Samen, wie etwa der Nußhäher (Corvus cariocatactes) und der Pyrrhocorax... Die Indianer versichern, der Guácharo gehe weder Insekten aus der Ordnung der Lamelliocornia (Käfern) noch Nachtschmetterlingen nach, von denen die Ziegenmelker sich nähren.[30] Diese Auffassung wurde später bestätigt. 3. Anregung von Malern durch Humboldt. Die Caripe-Höhle als kunsthistorisch wichtiger Ort Die Höhle von Caripe war mehrfach Gegenstand künstlerischer Darstellung, vor allem durch Ferdinand Bellermann, aber auch 1867 durch den Ornithologen Anton Goering. Humboldt hatte Bellermann im Mai 1842, als der junge Künstler ihn vor seiner Abreise nach Südamerika in Potsdam besuchte, in der Überzeugung, dass Künstler die Höhle komplexer als Naturwissenschaftler wahrnehmen können, den Besuch der Sehenswürdigkeit von Caripe dringend empfohlen.[31] Humboldt war sich sicher, dass der Eindruck, den die Höhle, die er fast 40 Jahre zuvor als erster Europäer besucht und in seinem Tagebuch ausführlich beschrieben hatte, auch dem Maler unauslöschlich in Erinnerung bleiben werde. Humboldt sollte recht behalten – Bellermann hielt das Naturwunder auf vielfältige Weise fest, schuf auch mehrere Ölstudien, die eine intensive Beschäftigung mit dem geheimnisvollen Ort erkennen lassen. Moritz, ursprünglich Entomologe, aber auch in der Botanik bewandert und als solcher einer der Reisebegleiter Bellermanns, schilderte die erste Begegnung mit dem Ort: […] aus dem Dickicht hervortretend, [befanden wir uns P.W.] vor einem majestätischem Gewölbe von 70 Fuß Höhe und 80 Fuß Breite befanden. Herr Bellermann und ich brachen gleichzeitig in einen Ausruf des Erstaubens aus, der sich besonders, wie Sie denken können, bei dem Landschaftsmaler als höchstes Entzücken äußerte, hier einen Vorwurf für seine Kunst zu finden, der alle seine Erwartungen bei Weitem übertraf.[32] Moritz schilderte Einzelheiten: Der den Eingang sperrende, zwölf bis fünfzehn Fuß breite Bach mußte eine Brücke haben. Die zum Holzholen abgeschickten Indianer blieben uns zu lange. Wir legten daher selbst Hand an, indem wir große Steine in das Wasser wälzten, und bald einen unterbrochenen Steindamm zu Stande brachten, der uns einen trockenen Uebergang gewährte. Am eifrigsten bei dieser Arbeit zeigte sich unser guter Capuciner, Pater Nicolas, der, sein falbes, bis auf die Sohlen reichendes Ordenskleid hoch aufgeschürzt, die schwersten herbeigeholten Felsstücke in die Reihe zu bringen sich abmühte. Einer der Ersten, der diese Nothbrücke benutzte, war unser eifriger Maler Bellermann, der, begeistert von dem Gedanken, diesen Grotten-Eingang zu malen, raschen Schrittes hinübereilte, den günstigsten Aussichtspunkt suchte und, da Bäume und Gesträuch die Aussicht theilweise hemmten, diese umhauen ließ.[33] Bellermann wechselte mehrfach die Perspektive, malte mehrere Außenansichten und begab sich auch in die Höhle, um Innenansichten zu malen. An den Generalintendanten der Preußischen Museen, Ignaz von Olfers, schrieb er begeistert: Die Höhle ist das schönste was ich bisher gesehen und ich wünsche nur dass meine Abbildungen von ihr dieß bestätigen; während unsres Aufenthaltes in derselben haben wir sie in allen ihren Theilen durchsucht.[34] Humboldt, der sich nicht nur für die Finanzierung und Organisation der Reise Bellermanns verwendet hatte, übermittelte dem Maler auch den Wunsch des Generalintendanten zur Bildgestaltung. Humboldts Vorschläge[35] wirken unfreiwillig komisch – so wünschte er, Bellermann möge im Vordergrund einige tote Guácharos einfügen, etwa so, dass man „denken (könne, P. W.) dass sie daliegen um am Feuer das Fett im Kessel herzugeben“. Dieser von Humboldt als „wenig listig“ geäußerte Wunsch war für den alten Gelehrten Anlass, den jungen Maler mit Zeichnungen[36] und zahlreichen Informationen zu „versorgen“. Er korrigierte nicht nur die Schreibweise der Höhle, sondern erklärte den Namen der Vögel nach dem „alt ächt“ spanischen Wort, wonach man auf Deutsch „Guatscharo“ zu schreiben hätte, „Un guácharo heißt auf spanisch ein weinerlicher Schreihals, einer der Klagegeschrei ausstösst.“[37] Geradezu grotesk wirken Humboldts weitere „Empfehlungen“. Er äußerte nicht nur den Wunsch, tote Vögel einzubeziehen, sondern schlug ernsthaft vor, wie das alles umzusetzen sei: Daß bei einer so ansehnliche Grösse es rathsam wäre im Vordergrunde wenigstens einen Vogel mit ausgespreizten Flügeln und auf gesperrtem weiten Rachen mit Barthhaaren unter dem Auge um das Maul anzubringen. Da das characteristische des Vogels das weiss gesprenkelte der Flügel ist, so müssen Sie die ausgespreizten Flügel (wenigsten bei einem Vogel) nicht von innen oder von unten, sondern von oben gesehen abbilden Kopf wie ein sehr grosser Rabe, Fuß wie ein Huhn Färbung wie unser Nachtvogel Ziegenmelker der von Insecten lebt, wenn der Guacharo nur Früchte frisst.[38] Damit der Maler das alles ausführlich beachten konnte, teilte ihm Humboldt nicht nur seine eigenen Forschungsergebnisse zu Gesamtgröße und Flügelspanne mit, schickte ihm auch noch die erwähnten Zeichnungen, sondern kündigte ihm, damit er sich ein Gesamtbild von dem Vogel machen konnte, an, dass ihm sein Hausdiener Johann Seifert (der passionierter Jäger war und sich lieber als solcher denn als „Diener“ bezeichnete) ein „schönes aber sehr kleines Paar Guacharo (mein Steatornis, Fettvogel) leihen [werde].“[39] Es gibt bisher keinen Beleg dafür, dass Bellermann dieser Empfehlung folgte, allerdings sind nicht alle Bilder von der Caripe-Höhle erhalten geblieben. Mehrere dieser Bilder wurden auf Akademie-Ausstellungen in Berlin präsentiert. Die akribische Aufzählung von Pflanzen durch Humboldt, die auch in sein botanisches Werk einging, regte Bellermann und die ihn begleitenden Naturforscher sowie auch die späteren Besucher der Höhle zu Vergleichen an, wie sich die Vegetation seit Humboldts Besuch verändert hatte. Nicht nur Humboldt, sondern auch Ignaz von Olfers legte bei allen Arbeiten Bellermanns auf die botanische Identifizierbarkeit der dargestellten Gewächse Wert. Hier konnte sich Bellermann auf die Hilfe von Botanikern stützen, so half ihm Carl Moritz bei der Bestimmung von Einzelpflanzen. In einigen Fällen wurden die Pflanzen im Nachhinein von anderen Botanikern bestimmt.[40] Der Künstler (= Ferdinand Bellermann) und der Naturforscher (= Carl Moritz) bestätigten den Nachweis einiger Pflanzen, die schon Humboldt entweder in der Höhle oder in ihrer Nähe gefunden hatte (wie z. B. Raphanus pinatus und die Palme Aiphanes praga usw.), vermissten aber auch zahlreiche, darunter Genipa americana.[41] Neben weiteren Wissenschaftlern besuchten später auch verschiedene Künstler die Höhle und malten sie, darunter der vornehmlich als Ornithologe tätige Anton Goering, der 1867 ein Gemälde der Höhle schuf, das verloren gegangen ist – in späterer Literatur wird eine schwarz-weiß-Darstellung erwähnt.[42] Literatur Anonym 1818 Anonym: Sur le Steatornis, noveau genre d’Oiseau nocturne, par M. de Humboldt. Kommentierende Wiedergabe. In: Isis 2 , H. 3 (1818), Sp. 411–412. De Bellard Pietri 1969 De Bellard de Pietri, Eugenio: Atlas espeleologico de Venezuela Nr. 173. Editorial sucre. Caracas 1969. Blum 2004 Blum, Wilhelm: Höhlengleichnisse. Thema mit Variationen. Bielefeld 2004. Humboldt 1792 Humboldt, Alexander von: Versuche und Beobachtungen über die grüne Farbe unterirdischer Vegetabilien. In: Journal der Physik 5, H. 2 (1792), S. 195–204. Humboldt 1792a Humboldt, Alexander von: Neue Beobachtungen über die grüne Farbe unterirdischer Vegetabilien. In: Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunde und Manufakturen, Bd. 1, St. 3 (1792) S. 254–255. Humboldt 1792b Humboldt, Alexander von: Auszüge aus Briefen an den Herausgeber [Paul Usteri]) von Hr. von Humboldt vom 10. Jan. 1792. In: Humboldt 1973, S. 164–167). Humboldt 1792c Humboldt, Alexander von: Lettre de M. Hoboldt [sic], à M. Delamethrie [Jean-Claude de Lamétherie]. Sur la couleur verte des Végétaux qui ne sont pas exposés à la lumière. In: Humboldt 1973, S. 167–168. Humboldt 1793 Humboldt, Alexander von: Flora Fribergensis specimen plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens. Accedunt aphorismis ex doctrina physiologiae chemicae plantarum cum tabulis aeneis. Berlin 1793. Humboldt 1793a Humboldt, Alexander von: Bemerkungen zum Erscheinen von Flora Fribergensis. In: Annalen der Botanick. Hrsg. von Paulus Usteri. Bd. 6 (1793), S. 164–166. Humboldt 1794 Humboldt, Alexander von: Ein bisher unveröffentlichtes botanisches Manuskript Alexander von Humboldts : Über „Ausdünstungs Gefäße“ (=Spaltöffnungen) und „Pflanzenanatomie“ sowie „Plantae subterranea Europ.“ 1794, cum Iconibus. Hrsg. von Klaus Dopat, Wiesbaden 1967 (Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz, Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1967). Humboldt 1795 Humboldt, Alexander von: Ueber Grubenwetter und die Verbreitung des Kohlenstoffs in geognostischer Hinsicht (aus einem Briefe an Hrn. Prof. Lampadius von Hrn. F. A. v. Humboldt). In: Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunde und Manufakturen, 8 (1795), S. 99. Humboldt 1796 Humboldt, Alexander von: „Ueber die einfache Vorrichtung, durch welche sich Menschen stundenlang in irrespirablen Gasarten, ohne Nachtheil der Gesundheit, und mit brennenden Lichtern aufhalten können; oder vorläufige Anzeige einer Rettungsfläche und eines Lichterhalters. In: Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunde und Manufakturen, 2 (1796), S. 99–110; 195–210. Humboldt 1799 Humboldt, Alexander von: Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über einige andere Gegenstände der Naturlehre. Braunschweig 1799. Humboldt 1799a Humboldt, Alexander von: Über die unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren Nachtheil zu verhindern. Ein Beitrag zur Physik und practischen Bergbaukunde. Braunschweig 1799. Humboldt 1806 Humboldt, Alexander von: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Königl[ichen] Preuß[ischen] Academie der Wissenschaften am 30. Januar 1806. Ein Abdruck für Freunde. Berlin 1806. Humboldt 1806a Humboldt, Alexander von: Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie. Gesammelt auf einer Reise nach den Tropenländern des neuen Kontinents von 1799–1804. Tübingen 1806. Humboldt 1817 Humboldt, Alexander von: Sur le Steatornis, nouveau genre d’Oiseau nocturne. In: Bulletin des sciences, par La Société philomathique de paris année 1817. Paris 1817. Humboldt 2000 Humboldt, Alexander von: Alexander von Humboldt. Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Reisetagebüchern. Hrsg. von Margot Faak. Berlin 2000 (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 12). Humboldt/Bonpland 1813–1833 Humboldt, Alexander/Aimé Bonpland: Recueil d’observations de zoologie et d’anatomie comparée. Deuxième volume. Paris 1813–1833. Humboldt 1845 Humboldt, Alexander von: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Bd. 1. Tübingen 1845. Humboldt 1960 Humboldt, Alexander von: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. Hrsg. von Mauritz Dittrich. Leipzig 1960 (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 248). Humboldt 1973 Humboldt, Alexander von: Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts 1787–1799. Hrsg. v. Ilse Jahn und Fritz G. Lange. Berlin 1973 (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 2). Humboldt 1991 Humboldt, Alexander von: Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents. 2 Bde. Hrsg. von Ottmar Ette. Frankfurt a. M. 1991. Kölbel u. a. 2008 Kölbel, Bernd u. a.: Das Fragment des englischen Tagebuches von Alexander von Humboldt. In: HiN (Alexander von Humboldt im Netz), IX, 16 (2008) S. 10–23. http://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin16/koelbel.htm Moritz 1844 Moritz, Carl: Ausflug in die Provinz Cumaná; Besuch der Guacharo-Höhle vom 5. November 1844. In: Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen Nr. 13 vom Dienstag, dem 16. Januar 1844. Müller 1842 Müller, Johannes: Anatomische Bemerkungen über den Quacharo Steatornis caripensis v. Humb. In: Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin (1842), S. 1–11. Nelken 1980 Nelken, Halina: Alexander von Humboldt. Bildnisse und Künstler. Eine dokumentierte Ikonographie. Berlin 1980. Ploss 1962 Ploss, Emil Ernst: Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter mit einem Ausblick auf die festen Farben. Heidelberg/Berlin 1962. Schwarz 2013 Schwarz, Ingo: Alexander von Humboldt. Chronologische Übersicht über wichtige Daten seines Lebens. Auf der Grundlage der Daten von Kurt R. Biermann, Ilse Jahn und Fritz G. Lange, Margot Faak und Peter Honigmann (Berlin 1983) ständig erweitert. http://avh.bbaw.de/chronologie (letzter Zugriff 18.4.2014) Trimmel 1973 Trimmel, Hubert: Bericht über den 6. Internationalen Kongress für Speläologie in Olmütz (Tschechoslowakei) im September 1973. In: Die Höhle, Zeitschrift für Karst- und Höhlenkunde 23 (1973). Werner 2008 Werner, Petra: Bemerkungen zu Alexander von Humboldts Russland-Tagebuch. In: HiN (Humboldt im Netz) IX, 16 (2008), S. 41–49. http://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin16/werner.htm (letzter Zugriff: 18.4.2014) Werner 2013 Werner, Petra: Naturwahrheit und ästhetische Umsetzung. Alexander von Humboldt im Briefwechsel mit bildenden Künstlern. Berlin 2013 (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 38). Werner 2014 Werner, Petra: Bei den „Vögeln der Hölle“. Ferdinand Bellermann und seine Begleiter auf Alexander von Humboldts Spuren in der Guácharo-Höhle von Caripe (Venezuela). Beitrag für den Katalog der Bellermann-Ausstellung in Erfurt 2014. Im Druck. Werner/Schwarz Werner, Petra/Schwarz, Ingo: „Eine Erinnerung an Ihren für die Wissenschaft und Kunst so folgereichen Aufenthalt in Südamerika…“. Der Briefwechsel Alexander von Humboldt – Ferdinand Bellermann. Beitrag für den Katalog der Bellermann-Ausstellung in Erfurt 2014. Im Druck. Zitierweise Werner, Petra (2014): Innenwelten und bleiche Gärten. Alexander von Humboldt untertage und in der Caripe-Höhle. In: HiN - Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien (Potsdam - Berlin) XV, 29, S. 51-60. Online verfügbar unter: <http://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin29/werner.htm> Permanent URL unter <http://opus.kobv.de/ubp/abfrage_collections.php?coll_id=594&la=de> [1] Ingo Schwarz gewidmet. [2] Genaue Angaben zur Häufigkeit der Fahrten sind nicht bekannt. Humboldt fuhr während seines Studiums in Freiberg, das 8½ Monate dauerte, mehrfach ein, aber auch später. In einem Brief an Dietrich Ludwig Gustav Karsten vom 25. 8. 1791 machte er Angaben zu seinen „Einfahrten“ während des Studiums. Demnach fuhr er jeden Tag der Woche (außer Mittwochs und Sonnabends) ein und zählte auch die Namen der verschiedenen Gruben auf. Vgl. Humboldt 1973, S. 144. Zu Angaben zur Befahrung einiger Gruben vgl. auch die unter Leitung von Ingo Schwarz von der Alexander-von-Forschungsstelle herausgegebene Chronologie zum Leben Humboldts (Schwarz 2013). [3] Vgl. Humboldt 2000, Bd. 12, S. 155. [4] Vgl. Blum 2004, S. 10–11. [5] Humboldt 1991 Bd. 1, S. 351–352. [6] Ebenda. [7] Humboldt 1796. [8] Humboldt 1799, Humboldt 1799a. [9] Humboldt 1792, Humboldt 1792a, Humboldt 1792b, Humboldt 1792c, Humboldt 1793, Humboldt 1794. [10] Vgl. Werner 2008, S. 43. [11] Brief Alexander von Humboldts an Paul Usteri vom 28.11.1789. In: Humboldt 1973, S. 74–75. [12] Zu Einzelheiten vgl. Kölbel u. a. 2008, S. 17–18. [13] Altfranzösisch, „Farbe vom Kraut, das sich zur Sonne wendet“, Bennennung für den als trockenen Brei gehandelten Farbstoff, ins Deutsche als „Tornisol“ entlehnt. Wurde seit dem 11. Jahrhundert auch von Malern verwendet. Vgl. Ploss 1962, S. 84. [14] Humboldt 1845, S. 447. [15] Vgl. Staatsbibliothek Berlin Preußischer Kulturbesitz, HS-Abteilung, NL A. v. Humboldt, Kasten 4, Nr. 44a. [16] Ebd., Nr. 39. [17] Humboldt 1806, S. 17–18. [18] Humboldt 1991, Bd. 1, S. 351. [19] Ebenda. [20] Das geht aus einem Brief Alexander von Humboldts an Gabriel Wegener vom 24., 25. und 27. Februar 1789 hervor, wo es heißt: „Eben komme ich von einem einsamen Spazirgange aus dem Thiergarten zurück, wo ich Moose und Flechten und Schwämme suchte[…]“. In: Humboldt 1973, S. 41. Seine Vorliebe für Pilze und Algen wird u. a. auch in einem Brief an Alexander Burggraf zu Dohna-Schlobitten (etwa Februar 1789) erwähnt. Siehe ebenda, S. 46. Auch bestätigt durch verschiedene Schreiben an Paul Usteri, u. a. vom 8. August 1789 und vom 28. November 1789. Siehe ebenda, S. 64 sowie S. 74. [21] Humboldt 1960, S. 30. [22] Humboldt 2000, Bd. 12, S. 157. [23] Vgl. u. a. Humboldt 1817, S. 51–52. Im zweiten Band der Isis wurde 1818 eine inhaltliche Zusammenfassung von Humboldts Forschungen über den Nachtvogel auf Deutsch gegeben. Vgl. Anonym 1818, Sp. 411–412. [24] Die Zeichnung mit u. a. Kopf, Extremitäten, Kehlkopf wurde als Tafel 44 veröffentlicht in Humboldt/Bonpland 1813–1833, Tafel 44. Ette wiederholte diese Abbildung verdienstvoller Weise in: Humboldt 1991, Bd. 1, S. 355. Die in Privathand befindlichen Originale sollen demnächst öffentlich präsentiert werden. [25] Vgl. Humboldt 2000, Bd. 12, Tagebuch A. v. Humboldts, S. 155–156. [26] Vielfach veröffentlicht, u. a. in Nelken 1980, Werner 2013. [27] Vgl. Müller 1842, S. 2ff. Den Hinweis auf diese Literatur und ausführliche Erläuterungen über am Naturkundemuseum zu Berlin erhaltene Guácharo-Präparate (Steatornis caripensis Humboldt, 1817) verdanke ich meinem Kollegen Carsten Eckert, Museum für Naturkunde Berlin. Demnach existieren im Museum zwei von Zeitgenossen Humboldts mitgebrachte Exemplare, die unter den Nummern Aves ZMB 9023 und ZMB 9024 inventarisiert sind. [28] Vgl. u. a. de Bellard Pietri 1969 sowie Trimmel 1973, S. 118. [29] In der deutschen Ausgabe konnte der Vogel nicht nachgewiesen werden (vgl. Humboldt 1806a, Kapitel „Über das Zungenbein und den Kehlkopf der Vögel, Affen und des Krokodils). [30] Humboldt 1991, Bd. 1, S. 353–354. [31] Werner 2013, S. 251. [32] Moritz 1844. (27. 1. 1844). Die Autorin ist dabei, eine Edition vorzubereiten. [33] Moritz 1844, (15.4.1844). [34] Werner 2013, S. 255. [35] Werner 2014. [36] Die Vorlagen befinden sich in Privatbesitz und werden abgedruckt in Werner 2014. [37] Vgl. Brief Alexander von Humboldt an Ferdinand Bellermann ohne Datum, Archiv Martin Bellermann, Düsseldorf, NL Ferdinand Bellermann, Alexander von Humboldt Nr. 4. [38] Wie FN Nr. 36. Vgl. auch: Werner/Schwarz 2014. [39] Ebenda. [40] Vgl. Werner 2013, S. 257. [41] Moritz 1844, (15. April 1844). Den Hinweisen, dass Humboldt Fundstücke aus der Caripe-Höhle in sein Herbar aufgenommen hat, will die Autorin noch nachgehen. [42] Vgl. Trimmel 1973.
|
|||||
 |
______________________________________________________ www.hin-online.de |
kraft@uni-potsdam.de |
 |